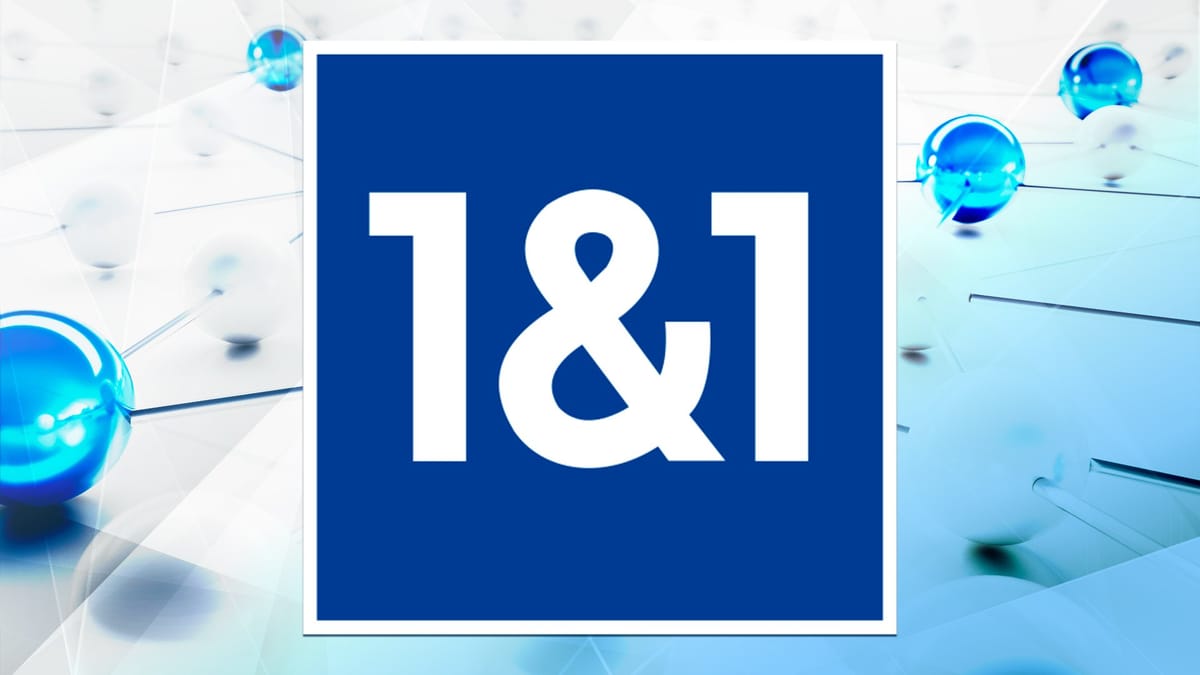Roaming-Falle: Wie ein Vertrag zur Kostenexplosion führte
Es war ein Vertragswerk, das in der Branche zunächst für Staunen sorgte. Dommermuth, lange als harter Verhandler gefürchtet, hatte sich von Telefónica gelöst und war zu Vodafone gewechselt – mit der Aussicht auf stabile, berechenbare Roaming-Gebühren.
So jedenfalls die Theorie. Die Realität sieht anders aus: Das Modell, das 1&1 zur Zahlung prozentualer Anteile am Vodafone-Datenvolumen verpflichtet, ist in Wahrheit eine Wette – auf etwas, das der Konzern selbst kaum beeinflussen kann.
Denn je erfolgreicher 1&1 ist, desto mehr zahlt es. Je weniger Vodafone wächst, desto stärker steigt der Preis für die Daten seiner neuen Konkurrenz. Das Prinzip erinnert an eine Steuer auf Expansion – nur dass sie nicht vom Staat kommt, sondern vom Vertragspartner.
Unlimited-Tarife, begrenzter Weitblick
Dommermuth hatte große Pläne. Mit Kampfpreisen und günstigen Unlimited-Tarifen wollte er Kunden von der Konkurrenz abwerben. Was er offenbar unterschätzte: Je mehr Daten seine Kunden verbrauchen – etwa durch den Wechsel vom gedrosselten 4G-Netz auf die schnelle Vodafone-5G-Verbindung – desto höher fallen die Roaming-Kosten aus. Und das in einem Vertrag, der genau diese Dynamik teuer bestraft.
Die Folge: Eine erneute Gewinnwarnung. Diesmal geht es um 26 Millionen Euro. Der eigentliche Schaden dürfte langfristig größer sein.
Die zweite Bauchlandung in nur zwölf Monaten
Schon 2024 hatte Dommermuth sich bei der Dimensionierung seiner Netzkomponenten verkalkuliert – damals kostete ihn das 46 Millionen Euro. Jetzt stolpert er über den nächsten Fehler.

Und wieder geht es um Infrastruktur. Genauer: Um die, die ihm nicht gehört. 1&1 baut noch immer an seinem eigenen Netz. Erst 1000 Antennen stehen, Jahre nach dem offiziellen Start. Die Frequenzen liegen brach. Ohne Roaming wäre der Anbieter faktisch nicht erreichbar.
Der Status „vollwertiger Netzbetreiber“ wirkt in diesem Licht eher wie ein PR-Titel als eine technische Realität. Dass die Bundesnetzagentur bisher keine Sanktionen verhängt hat, ist ein politischer Nebenschauplatz. Am Kapitalmarkt aber ist das Urteil längst gefallen.
Ein Vertrag mit eingebautem Anreiz zur Stagnation
Pikant ist die Logik hinter dem Roaming-Deal: Je weniger Vodafone in den Ausbau investiert und je langsamer das eigene Kundengeschäft wächst, desto mehr Geld fließt von 1&1 nach Düsseldorf. Der Vertrag belohnt gewissermaßen die Passivität des einen – auf Kosten des aktiveren Partners.
Vodafone selbst wächst im Mobilfunk derzeit kaum: 200.000 neue Verträge im Jahr – ein Bruchteil dessen, was 1&1 aktuell migriert. Bis Ende 2025 sollen zwei Millionen weitere Kunden von Telefónica auf das Vodafone-Netz wechseln. Damit erhöht sich das Datenvolumen – und mit ihm die Roaming-Rechnung.
Ein Vertrag, der eigentlich Planbarkeit bringen sollte, entwickelt sich zur finanziellen Zeitbombe.
„Freibier macht durstig“ – Datenflatrate mit Nebenwirkung
Ein weiterer Fehler liegt im Verhalten der Kunden. Jahrzehntelang geprägt von Drosselungen und Datendeckeln, nutzen viele 1&1-Kunden die neue Netzfreiheit mit ungeahnter Intensität. Warum noch ins WLAN einloggen, wenn das mobile Netz endlich schnell und unbegrenzt ist?
Dommermuth setzte darauf, dass sich das Nutzungsverhalten nur langsam ändert. Doch die Rechnung geht nicht auf. Die Nutzer tun genau das, was man ihnen vorher verwehrt hat: streamen, surfen, downloaden – unterwegs, jederzeit, grenzenlos. Für 1&1 wird genau das jetzt teuer.
Der Netzausbau stockt – und die Finanzierung wackelt
Die Ironie ist bitter: Um sich aus der Roaming-Falle zu befreien, müsste 1&1 sein eigenes Netz massiv ausbauen. Doch dafür braucht es Kapital. Und genau das wird durch die sinkenden Margen immer knapper.
Ein Teufelskreis. Je mehr das Unternehmen wächst, desto stärker belasten die Roaming-Kosten das Ergebnis – und desto schwieriger wird die Finanzierung für eigene Infrastruktur.
So entsteht aus dem ambitionierten Mobilfunkprojekt eine potenzielle Wachstumsfalle. Und aus dem Verhandlungsgenie Dommermuth ein Unternehmer, der sich strategisch verkalkuliert hat – möglicherweise folgenschwerer als je zuvor.
Was bleibt: Ein Vertrag, der Kontrolle kostet
Am Ende ist es ein Lehrstück in strategischer Naivität. Wer sich in einem auf Daten basierenden Geschäftsmodell von den Ausbau- und Marktentscheidungen eines Wettbewerbers abhängig macht, gibt das Steuer aus der Hand – selbst wenn das Netz vorübergehend besser ist als das eigene.
Dommermuth hat seine Zukunft an ein Modell geknüpft, das kalkulierbar schien – und sich als unkontrollierbar entpuppt hat. Ob er daraus herauskommt, hängt nun weniger von seiner Verhandlungsstärke ab – als von seiner Fähigkeit, endlich ein eigenes Netz zu bauen, das diesen Namen verdient.
Das könnte Sie auch interessieren: