Ein Imperium auf Pump
600 Millionen Dollar – so viel spült Donald Trumps Zollpolitik inzwischen täglich in die Staatskasse. Die Einnahmen aus Einfuhrabgaben haben die US-Haushaltszahlen aufpoliert, im Juni erreichten sie mit knapp 28 Milliarden Dollar ein Allzeithoch.
Für Trump ein Triumph: Zölle rauf, Steuern runter – und trotzdem fließt das Geld. Die Wirtschaft? Noch robust. Die Börsen? Gelassen.
Doch unter der Oberfläche brodelt es. Die Inflation zieht an. Die Industrie jammert. Der Schuldenberg wächst. Trumps einfache Rechnung – Ausländer zahlen die Zeche, Amerikaner profitieren – wird zur riskanten Wette. Und wenn das Pendel zurückschlägt, könnte es die US-Wirtschaft härter treffen als gedacht.
Trumps populistische Gleichung
„Make America Rich Again“ – mit Zolleinnahmen als neue Wunderwaffe. Während Reiche in den USA steuerlich entlastet werden, kassiert der Staat kräftig an Importwaren. Der durchschnittliche Einfuhrzoll liegt mittlerweile bei über 20 Prozent – dem höchsten Stand seit über 100 Jahren.
Für Konsumenten bedeutet das: höhere Preise. Für Unternehmen: höhere Kosten. Und für das Budget: kurzfristig eine Entlastung, langfristig ein Pulverfass.
Denn je länger Unternehmen die Mehrkosten schlucken, desto stärker wird der spätere Preisschub. „Eat the tariffs“, wie Trump es nennt, ist keine nachhaltige Strategie – sondern eine, die sich früher oder später in Inflation übersetzt.
Wenn Lager leer und Nerven blank liegen
Noch halten US-Retailer wie Walmart oder Amazon still. Sie verkaufen aus vollen Lagern, kompensieren Verluste aus Marge – und hoffen auf eine Einigung mit der Politik.

Doch Analysten wie Omair Sharif warnen: Im Spätsommer könnte sich die Situation drehen. Wenn Lagerbestände sinken und neue Lieferungen teurer werden, explodieren auch die Preise.
Die Teuerung ist schon messbar: Möbel, Textilien, Elektronik – überall steigen die Preise. Die Inflationsrate kletterte im Juni auf 2,7 Prozent. Noch moderat, aber mit Aufwärtstendenz. Sollte die Notenbank reagieren und die Zinsen anheben, wird die Finanzierung der gigantischen US-Staatsverschuldung endgültig zum Bumerang.
Ein Konjunkturprogramm für andere Länder
Trumps Zölle treffen nicht nur China oder Japan, sondern zunehmend auch europäische Exporteure. Ein neuer 30-Prozent-Zoll auf EU-Produkte steht im Raum – als Drohkulisse oder bald Realität.
Gleichzeitig steigen die Rohstoffpreise: Nach der Zollankündigung auf Kupfer schoss der Preis in die Höhe. Der Effekt: US-Industrieunternehmen müssen tiefer in die Tasche greifen, während ausländische Konkurrenten oft günstiger produzieren können.
General Motors spürt das schon heute. Allein im zweiten Quartal kosteten die Zölle den Konzern 1,1 Milliarden Dollar – das Ergebnis brach um ein Drittel ein. Und GM steht nicht allein da: Auch Maschinenbauer, Tech-Konzerne und Importeure von Elektronikkomponenten schlagen Alarm.
Wahlkampf auf Kosten der Zukunft
Trumps Zolloffensive ist vor allem eines: Wahlkampftaktik. Seine Anhänger feiern die Zahlen. Seine Gegner verweisen auf die Fallhöhe. Denn die langfristigen Effekte sind weder planbar noch reversibel. Einmal eingeführte Zölle schaffen Abhängigkeiten, verzerren Märkte und provozieren Gegenreaktionen.
Lesen Sie auch:
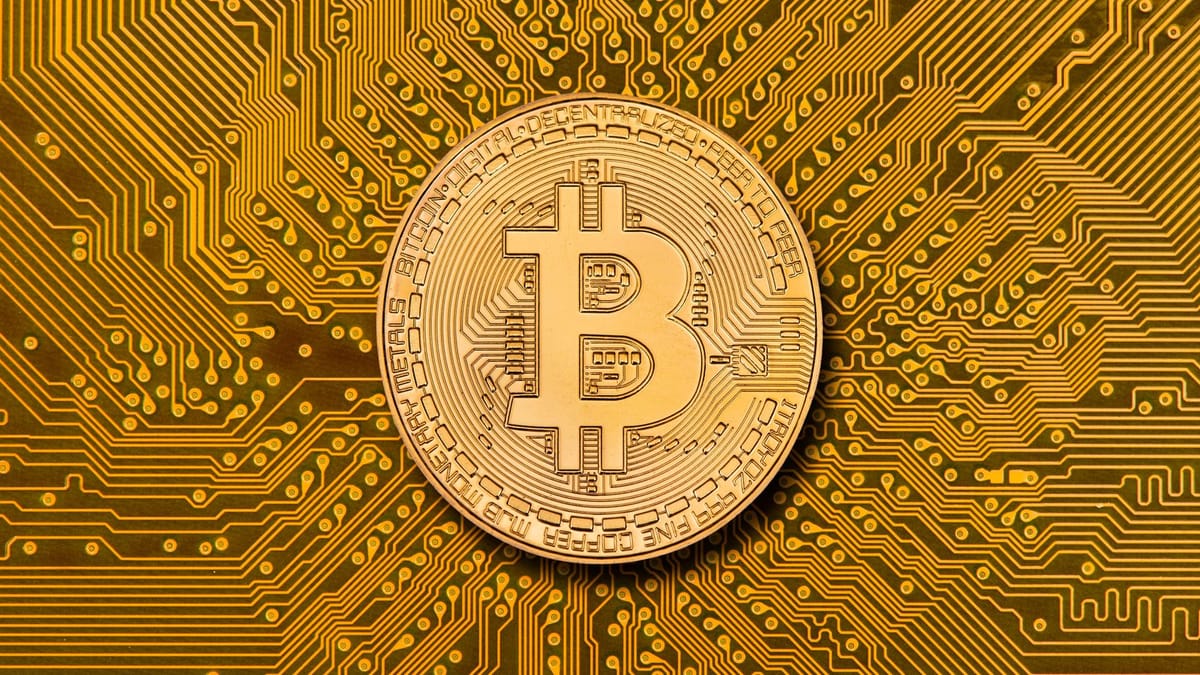
Sollte die EU tatsächlich zurückschlagen oder China erneut den Export von strategischen Rohstoffen drosseln, wird Trumps Plan vom profitablen Protektionismus ins Leere laufen. Ökonomen warnen vor einer sich selbst verstärkenden Spirale: Erst steigen die Kosten für Unternehmen, dann die Preise für Verbraucher – am Ende brechen Nachfrage und Vertrauen ein.
Das amerikanische Haushaltsmärchen
Was viele übersehen: Die sprudelnden Zolleinnahmen kaschieren ein anderes Problem – die wachsende Steuerlücke. Trumps Entlastungspaket für Wohlhabende, liebevoll „Big Beautiful Bill“ genannt, sorgt dafür, dass Top-Verdiener in den USA derzeit so wenig Steuern zahlen wie seit Jahrzehnten nicht. Kombiniert mit Rekordausgaben im Militär und Infrastruktursektor ergibt sich eine explosive Mischung.
Laut dem Yale Budget Lab belasten die Zölle einen durchschnittlichen US-Haushalt inzwischen mit rund 2.800 Dollar im Jahr. Eine Steuer durch die Hintertür – aber eben nicht progressiv, sondern regressiv.
Arme Haushalte zahlen im Verhältnis deutlich mehr. Das politische Narrativ? Funktioniert trotzdem: Amerika wird angeblich wieder reich – auch wenn es nur ein statistischer Taschenspielertrick ist.
Trumps letzte Rechnung
Noch funktioniert die Illusion: steigende Einnahmen, stabile Märkte, patriotische Rhetorik. Doch das Fundament bröckelt. Wenn Inflation, Zinsen und Schulden zusammenkommen, könnte die „Zollwette“ platzen – mit verheerenden Folgen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Trumps wirtschaftspolitischer Drahtseilakt gelingt.
Oder ob das Spiel mit Zöllen und Steuergeschenken am Ende das wird, was viele Experten längst prophezeien: Ein Crash mit Ansage.
Das könnte Sie auch interessieren:



