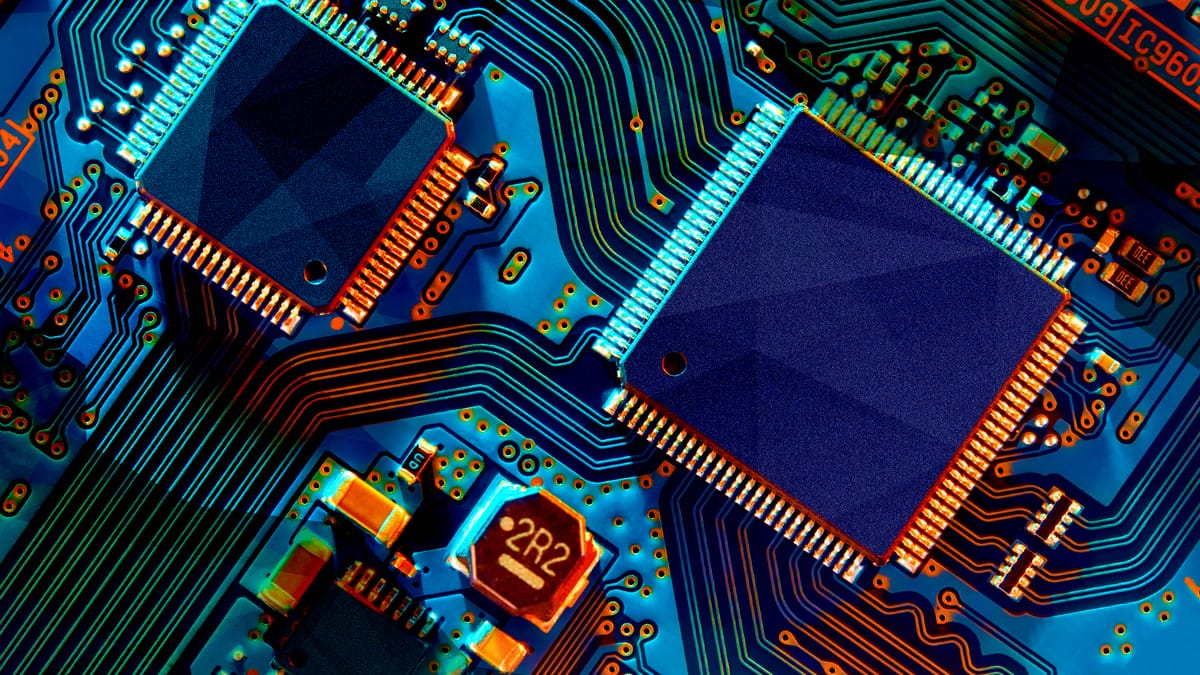Der zweite Versuch beginnt mit einem Rückschlag
Kaum ein anderes Projekt steht so sinnbildlich für die deutschen Ambitionen im Halbleitermarkt wie der geplante Intel-Campus in Magdeburg. Doch statt Spatenstich kam die Absage.
Jetzt folgt der nächste Anlauf: Die Bundesregierung kündigt drei neue Chipfabriken an – ohne zu sagen, wer sie bauen soll, wo sie stehen oder wann sie ans Netz gehen.
Stattdessen liefert das Forschungsministerium eine Hightech-Agenda, die gleich die ganz große Transformation skizziert: Deutschland soll zur Nummer eins in der europäischen Chipfertigung aufsteigen, ein globaler Hotspot für KI-Anwendungen werden, bei Fusionskraftwerken mitspielen und den Weltmarkt für Batteriespeicher anführen.
Die Schlagworte: Supercomputer, Quantenchips, militärische Dual-Use-Forschung, „Sprunginnovation“ – und ein staatlich unterstützter Deutschlandfonds, der privates Kapital aktivieren soll.
Milliardenpläne ohne Bauplan
Was auffällt: Es gibt viele Ziele, aber kaum belastbare Maßnahmen. Der Text liest sich wie ein Wunschzettel, nicht wie ein Finanzierungskonzept.
Weder sind konkrete Budgets ausgewiesen, noch Beteiligungen der Industrie benannt. Stattdessen setzt das Papier auf „Ankerkäufe“ durch den Staat, auf Kompetenzcluster für Batterietechnologie und auf eine strategische Verzahnung von ziviler und militärischer Forschung.

Das mag politisch ambitioniert klingen – ökonomisch ist es vor allem teuer. Schon heute ist klar: Ohne Milliarden an Subventionen wird kein einziges der geplanten Chipwerke entstehen.
Der globale Wettbewerb ist brutal, die Subventionen in den USA (CHIPS Act) und China (Staatsfonds) um ein Vielfaches größer. Wenn Deutschland mithalten will, muss es tief in die Haushaltskasse greifen – mitten in der Haushaltskrise.
Technologiepolitik mit Ansage – aber ohne Partner?
Das Problem ist nicht der Wille, sondern die Umsetzung. Schon beim ersten Anlauf mit Intel zeigte sich: Die Standortbedingungen in Deutschland sind schwächer als gedacht.
Genehmigungen dauern zu lange, Strompreise sind zu hoch, Planungsrecht zu komplex. Dass nun gleich drei neue Werke entstehen sollen, klingt mutig – oder naiv.
Wer diese Fabriken bauen und betreiben soll, bleibt offen. Namen wie TSMC, GlobalFoundries oder Bosch fallen nicht. Die Regierung bleibt vage. Stattdessen betont das Papier den Aufbau lokaler Vorleistungsindustrien, von Chemikalien bis Spezialanlagen – ohne zu sagen, wie. Die Last trägt wohl erneut der Steuerzahler.
Wagniskapital – oder staatlich gelenkte Innovation?
Ein Kernstück der Agenda ist der geplante „Deutschlandfonds“ – eine Art Investitionsvehikel zur Bündelung staatlicher und privater Mittel. Der Staat soll als Ankerkunde auftreten, also selbst Bestellungen aufgeben, um neue Produkte schneller in den Markt zu bringen.
Diese Form von „Market Making“ erinnert an chinesische Industriepolitik – und wirft Fragen nach Wettbewerbsneutralität auf.
Auch beim Thema Wagniskapital wird es konkret unkonkret: „Mehr privates Risikokapital mobilisieren“, heißt es. Wie? Offen. Welche steuerlichen Anreize? Fehlanzeige. Statt mutiger Finanzreformen setzt die Agenda auf staatlich koordinierte Innovationsprozesse – ein Modell, das in Deutschland bisher selten funktioniert hat.
Vom Supercomputer bis zur Fusionskraft – das neue Deutschland im Entwurfsmodus
Besonders ambitioniert ist das Ziel, bis Ende 2025 einen Plan für ein deutsches Fusionskraftwerk vorzulegen – wohlgemerkt in einem Land, das gerade die Kernspaltung aus dem Netz genommen hat. Auch der geplante Supercomputer „im Auto“ wirkt wie eine Formulierung aus einem Prospekt, nicht aus einem Planungsdokument.
Energieeffiziente Chips, Quantentechnologie, KI für industrielle Anwendungen – das sind ohne Zweifel Zukunftsfelder. Doch sie gedeihen nicht in Strategiepapieren, sondern in funktionierenden Ökosystemen aus Forschung, Finanzierung, Unternehmertum und regulatorischem Vertrauen. Genau hier hinkt Deutschland seit Jahren hinterher.
Das könnte Sie auch interessieren: