Der Westen verliert die Oberhand
Donald Trump ist zurück – und mit ihm eine Politik, die den Status quo des globalen Wirtschaftssystems infrage stellt. Was als Risiko begann, entwickelt sich zum Katalysator: Schwellenländer, lange als politisch instabil und wirtschaftlich unzuverlässig belächelt, profitieren von der neuen globalen Unsicherheit.
Während in den USA Treasury-Renditen steigen und der Dollar wankt, steigen Anleger aus – und suchen Rendite anderswo.
Die USA verhalten sich wie ein Schwellenland
Das ist nicht die Einschätzung linker Kritiker, sondern die Analyse erfahrener Fondsmanager wie Xavier Hovasse und Naomi Waistell.
Ihre Begründung: politische Institutionen unter Druck, steigende Haushaltsdefizite, eine taumelnde Notenbankpolitik und ein Präsident, der Zollschranken hochzieht wie andere den Rollladen. Wer einst in US-Dollar und Treasuries Zuflucht suchte, flüchtet nun aus ihnen.
China: Der unterschätzte Gigant
Noch vor wenigen Jahren galt China als Werkbank der Welt – effizient, billig, aber technologisch rückständig. Diese Einschätzung ist heute gefährlich veraltet.
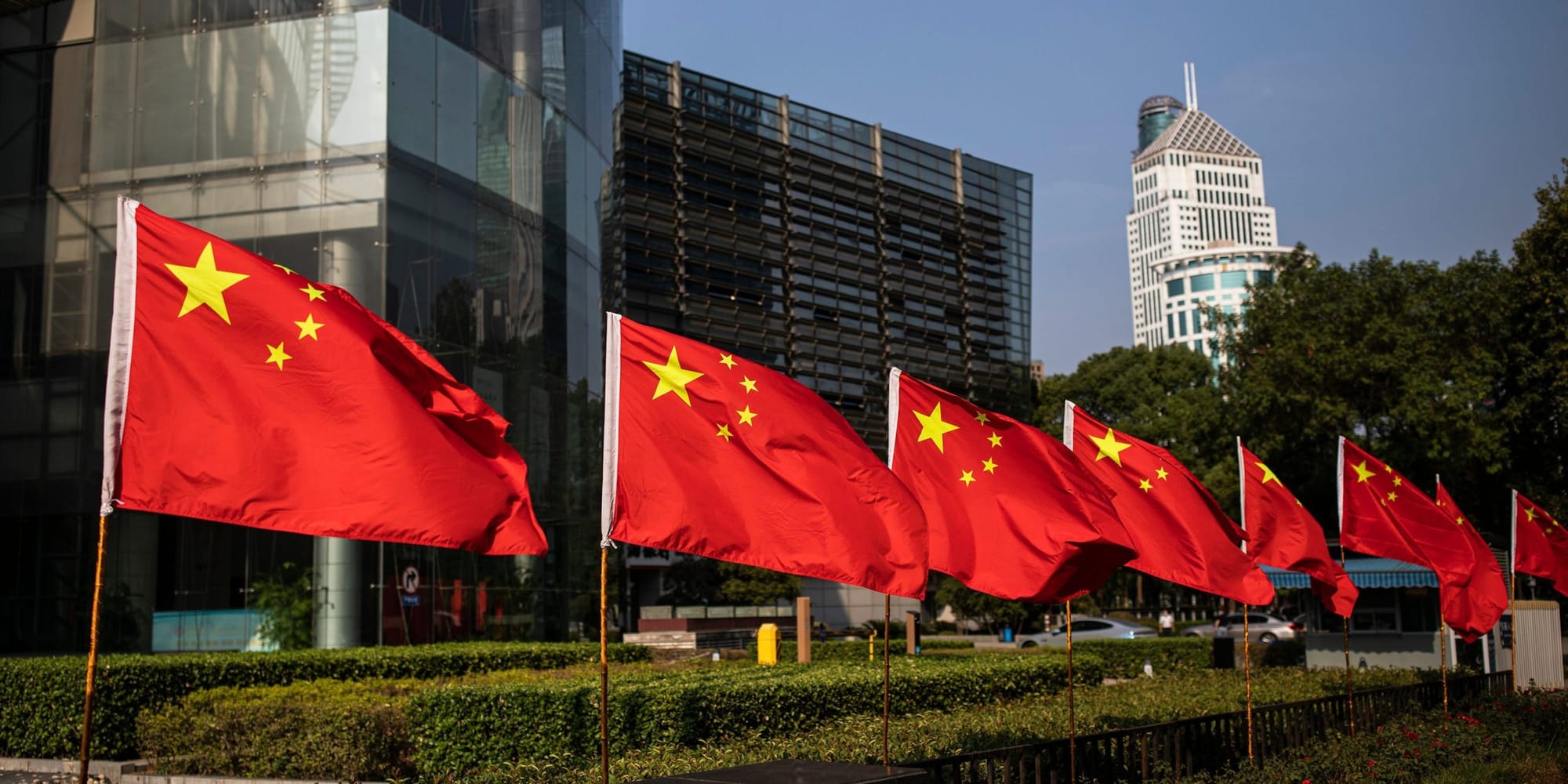
In Bereichen wie künstliche Intelligenz, E-Mobilität und erneuerbare Energien hat das Land den Westen teilweise überholt – angetrieben durch langfristige Investitionen, ein starkes Bildungssystem und eine Regierung, die strategisch denkt und handelt.
Der Tech-Krieg mit den USA hat Chinas Autarkiebestrebungen befeuert. Nvidia-Chef Jensen Huang spricht von „beeindruckenden Fortschritten“ chinesischer KI-Unternehmen, die längst eigene Chips entwerfen und bauen – trotz US-Sanktionen.
Während Europa noch über KI-Richtlinien debattiert, liefern Start-ups wie DeepSeek weltweit konkurrenzfähige Modelle. Wer heute in Tech investieren will, kommt an Shenzhen nicht mehr vorbei.
Asien: Mehr als nur China
Taiwan, Südkorea, Indien – Asien bleibt der Innovationsmotor der Weltwirtschaft. Während der Westen über Regulierung und Standortkosten stöhnt, entstehen in Fernost neue Tech-Dynastien. TSMC etwa fertigt sämtliche GPUs von Nvidia – und investiert zugleich 150 Milliarden Dollar in neue Werke, auch in den USA. Der Standortwettbewerb läuft längst.
Indien ist der andere große Aufsteiger. Politisch stabil, wirtschaftlich wachstumsstark und mit einer jungen, gut ausgebildeten Bevölkerung. Modi treibt die „Made in India“-Agenda energisch voran.
Und obwohl viele Vergleiche mit China noch zu früh sind: Die Dynamik ist spürbar. Prognosen des IWF rechnen mit über 6 % Wachstum jährlich in den kommenden 15 Jahren.
Lateinamerika: Der stille Gewinner von Trumps Zollpolitik
Während Europa noch rätselt, wie es seine Industriepolitik neu aufstellt, profitieren Mexiko, Brasilien und Argentinien längst vom Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Mexiko boomt als „Nearshoring“-Partner der US-Industrie, dank kurzer Wege und stabiler Politik unter Präsidentin Claudia Sheinbaum. Ihre Zusammenarbeit mit Trump mag vielen missfallen – wirtschaftlich aber zahlt sie sich aus.
Brasilien lockt Investoren mit einem der höchsten Realzinsen weltweit, massiven Infrastrukturbedarfen und einer wachsenden Öl- und Agrarproduktion. Versorger, lokale Banken und REITs bieten Renditen von bis zu 12 % – real, nicht nominal.
Argentinien unter dem libertären Präsidenten Milei überrascht mit fiskalischer Disziplin und einem Comeback seiner Staatsanleihen. Risiken bleiben, doch das Momentum stimmt.
Während Donald Trump seine zweite Amtszeit mit geopolitischen Muskelspielen beginnt, hat sich das Kräfteverhältnis in der Weltwirtschaft bereits verschoben. Die alten Gewissheiten – Sicherheit im US-Dollar, Wachstum aus dem Silicon Valley, Stabilität durch die Fed – wackeln. Schwellenländer hingegen zeigen, wie sich politische Umbrüche in Chancen verwandeln lassen.
China ist nicht mehr Werkbank, sondern Vorreiter. Indien nicht mehr ewiges Versprechen, sondern wirtschaftliche Realität. Brasilien nicht mehr Krisenstaat, sondern renditestarker Geheimtipp. Und die USA? Spielen erstmals seit Jahrzehnten nicht mehr automatisch die Hauptrolle im globalen Kapitalfluss.
Das könnte Sie auch interessieren:


