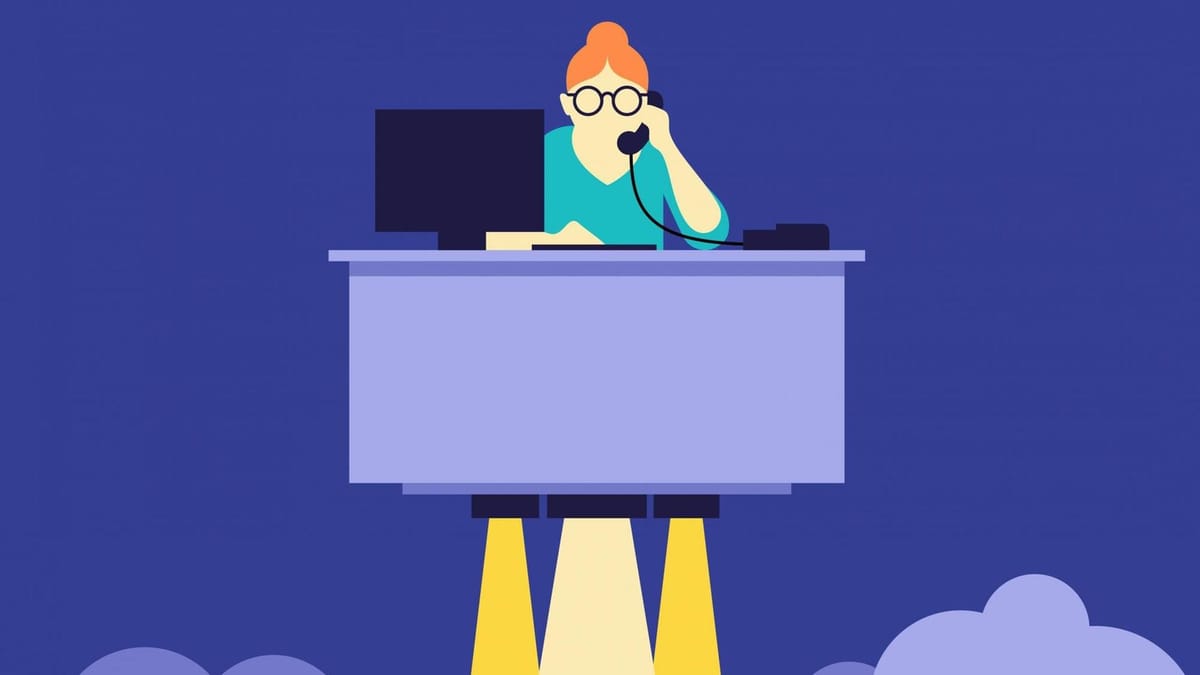Wenn sich Anstrengung nicht auszahlt
Mehr arbeiten, mehr verdienen, mehr haben – eigentlich ein simples Prinzip. Doch in der Realität des deutschen Sozialsystems funktioniert es oft genau andersherum. Wer sich bemüht, mehr zu verdienen, steht am Monatsende manchmal sogar mit weniger Geld da. Ökonom Andreas Peichl spricht von einem strukturellen Fehler. Und er meint nicht Kleinigkeiten, sondern das ganze System.
„Das alles ist überhaupt nicht aufeinander abgestimmt“, sagt Peichl.
Gemeint sind die Vielzahl an Sozialleistungen, Steuerfreibeträgen, Zuschüssen und Abgaben – und wie sie zusammenspielen. Oder eben nicht.
Absurd, aber kein Einzelfall
Das Szenario ist nicht theoretisch. Es betrifft Menschen, die ein paar Stunden mehr arbeiten wollen, eine kleine Gehaltserhöhung bekommen oder einen Minijob zusätzlich annehmen.
Was dann passiert: Kindergeldzuschläge, Wohngeld oder Bürgergeld werden gekürzt. Gleichzeitig steigt die Steuerlast. Am Ende bleibt netto oft kaum ein Unterschied. In einigen Fällen sogar ein Minus.
Peichl, Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik, hat über 60 Reformideen durchgerechnet. Sein Fazit: Das System erzeugt falsche Anreize – nicht, weil es zu viel gibt, sondern weil das Zusammenspiel fehlt.
Reform, die sich lohnt
Eine Reform wäre teuer – aber nicht unvernünftig. Peichl argumentiert, dass gezielte Änderungen zunächst Geld kosten könnten, langfristig aber höhere Beschäftigung und mehr Einnahmen für den Staat bedeuten würden.

„Eine sinnvolle Reform kann erst mal Geld kosten, weil wir etwa den Transferbereich ausweiten“, sagt er. Doch: Mehr Menschen in Arbeit, mehr Sozialbeiträge, mehr Steuereinnahmen – das rechnet sich.
Was laut Peichl nicht funktioniert: Einzelmaßnahmen ohne Blick auf das Ganze. „Wenn wir gesamtstaatlich draufschauen, gibt es Möglichkeiten, das Bürgergeld so zu reformieren, dass es sich selbst finanziert.“ Der Blick nur auf den Bundeshaushalt sei zu kurz gegriffen.
Sparen allein reicht nicht
CDU-Chef Friedrich Merz hatte angekündigt, das Bürgergeld zu überarbeiten – mit dem Ziel, die Ausgaben von über 50 Milliarden Euro zu senken. Die Hoffnung: Weniger Sozialausgaben, mehr Anreiz zu arbeiten.
Doch Peichl warnt: Eine Kürzung ohne Reform der Systemlogik könnte das Gegenteil bewirken. Wer arbeiten will, muss einen klaren Vorteil davon haben. Sonst bleibt die Rechnung für viele negativ – und der Sozialstaat wird zur Sackgasse.
Nicht weniger, sondern besser
Peichls Vorschläge sind kein Frontalangriff auf den Sozialstaat. Im Gegenteil. Sie zielen auf ein System, das wieder funktioniert – das sich nicht widerspricht, sondern gezielt unterstützt.
Weniger Bürokratie, klarere Regeln, ein Zusammenspiel von Steuer- und Sozialpolitik, das Anreize nicht untergräbt, sondern stärkt.
Die Forderung: Schluss mit den Bruchstellen im System, an denen Leistung bestraft statt belohnt wird.
Ein System auf dem Prüfstand
Deutschland braucht nicht weniger Sozialstaat. Es braucht einen, der wieder Sinn ergibt. Einen, der Menschen nicht ausbremst, sondern mitnimmt. Der nicht belohnt, wer im System bleibt, sondern wer sich bewegt. Andreas Peichl liefert dafür eine klare Diagnose – und konkrete Ansätze.
Was fehlt? Der politische Wille, das Dickicht aus Regelungen zu entwirren und neu zu denken. Denn solange sich Leistung nicht lohnt, ist auch der schönste Sozialstaat nur ein mathematisches Paradox – teuer, ineffizient und frustrierend.
Das könnte Sie auch interessieren: