Als Donald Trump am Mittwochabend den Übergangshaushalt unterschrieb, wirkte nichts an diesem Moment historisch – dabei war er es. Nach 43 Tagen Stillstand kann die US-Regierung wieder arbeiten. Der längste Shutdown, den das Land je erlebt hat, ist vorbei. Doch wer genauer hinsieht, merkt schnell: Gelöst wurde damit wenig.
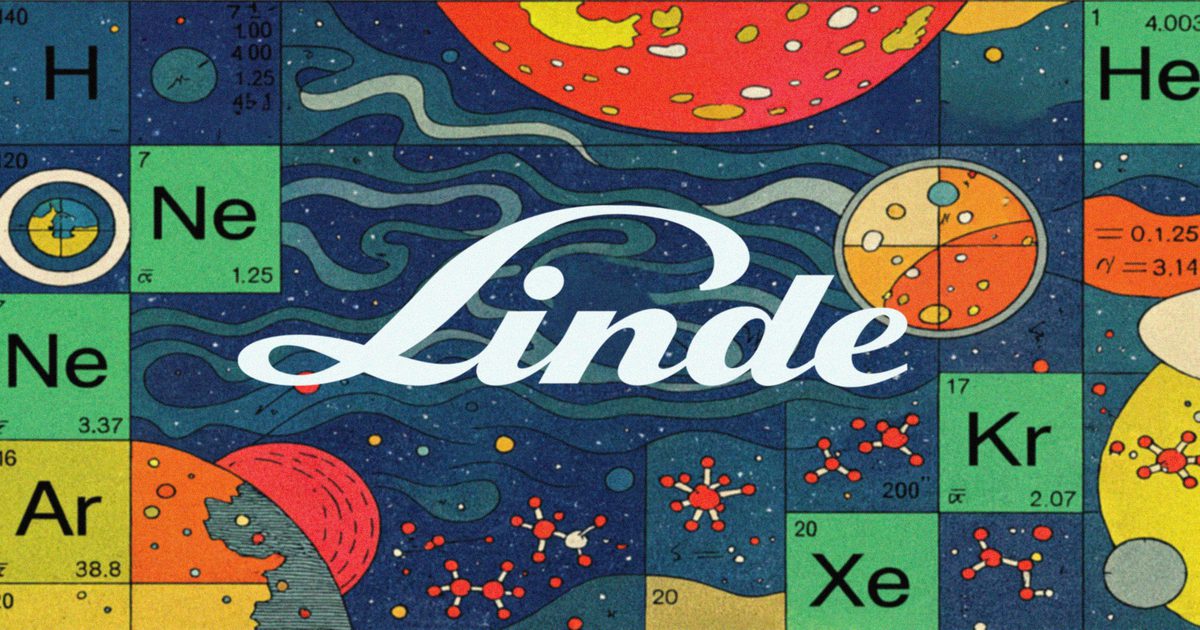
Ein Ende aus Erschöpfung
Der Ablauf war unspektakulär: Senat und Repräsentantenhaus stimmten zu, der Präsident gab grünes Licht, die Behörden dürfen wieder öffnen. Trump erklärte im Weißen Haus, Amerika lasse sich „nicht erpressen“. Ein Satz, der zu seiner Rhetorik passt, aber kaum darüber hinwegtäuscht, dass der politische Druck in den vergangenen Tagen enorm war – und wächst.
Denn 43 Tage ohne Haushalt haben Spuren hinterlassen. Beamte arbeiteten unbezahlt, Sozialprogramme liefen nur eingeschränkt, Flughäfen meldeten Personalmangel und gestrichene Flüge. Für ein Land, das sich gern als effizienteste Volkswirtschaft der Welt inszeniert, war der Shutdown ein peinlicher Offenbarungseid.
Demokraten im Zwangskorridor
Die entscheidende Bewegung kam ausgerechnet von jenen, die den Shutdown wochenlang verteidigten: einigen demokratischen Senatoren. Sie gaben nach und verhalfen dem Übergangshaushalt zu den benötigten Stimmen. Offiziell spricht man von einem Kompromiss – im Dezember solle über Gesundheitszuschüsse abgestimmt werden. Doch in der Partei rumort es. Viele sehen darin eher ein taktisches Zurückweichen als eine echte politische Lösung.

Dabei ging es für die Demokraten um ein Kernthema: die staatlichen Zuschüsse zu Versicherungsbeiträgen, die mehr als 20 Millionen Amerikanern den Zugang zu ihrer Krankenkasse sichern. Werden sie nicht verlängert, könnten die Prämien in manchen Bundesstaaten explodieren. Dass dieser Punkt nun vertagt wurde, ist für die Partei schwer zu verkaufen.
Wirtschaftlicher Schaden – und Datenlücken
Während die politische Debatte weiterläuft, rechnet die Wirtschaft bereits die Folgen zusammen. Der ehemalige Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, sprach von einem möglichen Wachstumsverlust von bis zu 1,5 Prozentpunkten. Auch wichtige Konjunkturdaten könnten schlicht ausfallen – weil die zuständigen Behörden während des Shutdowns geschlossen waren. Selbst für amerikanische Verhältnisse ist das ein ungewöhnlicher Vorgang.
In den Bundesbehörden herrscht unterdessen Erleichterung: Endlich wieder Arbeit, endlich wieder regelmäßige Bezahlung. Doch die Unsicherheit bleibt. Niemand weiß, ob der Übergangshaushalt länger hält als seine Vorgänger.
„40 Tage Streit – und niemand weiß, worum es ging“
Der republikanische Abgeordnete David Schweikert brachte das Gefühl vieler Kongressmitglieder treffend auf den Punkt. Der Streit habe ihn an eine Seinfeld-Episode erinnert: „40 Tage, und ich weiß immer noch nicht, was die Handlung war.“ Es ist ein bitterer Satz – und einer, der zeigt, wie sehr dieser Shutdown weniger politisches Ringen als politisches Ritual war.
Der Februar droht bereits
Der nun beschlossene Haushalt finanziert die Regierung nur bis Ende Januar. Dann beginnt alles von vorne. Wieder dieselben Konflikte, wieder dieselben Verhandlungsrunden, wieder dieselbe Frage: Wer bewegt sich zuerst?
In Washington spricht niemand offen aus, was viele befürchten: Das Land könnte schon Anfang Februar erneut in einen Shutdown rutschen. Die Fronten zwischen Republikanern und Demokraten sind dafür zu fest, der Wahlkampf zu nah, die Bereitschaft zum Kompromiss zu gering.
Ende ohne Auflösung
Dieser Shutdown endet – aber nicht, weil sich die politischen Lager einig geworden wären. Er endet, weil das Land an seine Belastungsgrenze kam. Weil Arbeitnehmer, Flughäfen, Sozialprogramme und Finanzmärkte irgendwann nicht mehr können.
Was bleibt, ist ein Übergangshaushalt, der seinen Namen verdient: eine Brücke in einen Februar, der bereits bedrohlich wirkt. Und eine amerikanische Politik, die selbst im Moment der Einigung deutlich macht, wie tief der Riss im System inzwischen verläuft.




