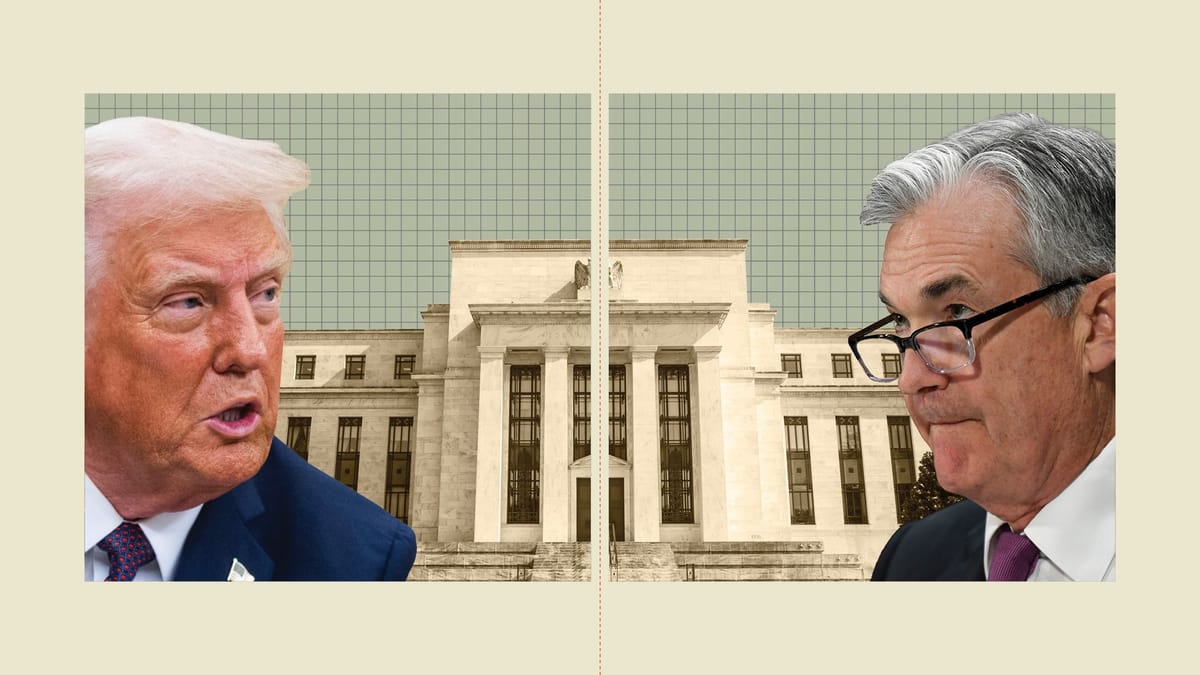Milliardenregen – aber nicht für alle
Nordrhein-Westfalen bekommt über 21 Milliarden Euro, Bayern fast 16. Baden-Württemberg liegt bei rund 13 Milliarden. Am anderen Ende: Bremen und das Saarland – jeweils knapp über einer Milliarde.
Das ist die neue Realität nach der Einigung der Länderfinanzminister über die Verteilung der 100 Milliarden Euro für Infrastruktur.
Die Entscheidung fiel bei der Finanzministerkonferenz in Kiel – schneller als erwartet, wie viele Beteiligte betonten. Doch während sich die finanzstarken Länder zufrieden zeigen, regt sich bei den kleineren erste Kritik. Denn nicht jeder kann mit dem Ergebnis leben.
Der Königsteiner Schlüssel schlägt zu
Entschieden wurde nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“. Eine Formel, die eigentlich aus der Forschung stammt, später bei der Verteilung von Asylbewerbern übernommen wurde – und nun auch über Geld für Straßen, Schulen und Bahnhöfe bestimmt.
Zwei Drittel der Berechnung beruhen auf dem Steueraufkommen eines Landes, nur ein Drittel auf der Bevölkerungszahl.

Heißt im Klartext: Wer ohnehin wirtschaftlich gut aufgestellt ist, bekommt am meisten. Länder wie Bremen, das Saarland oder Sachsen-Anhalt fallen ab. Deren Minister hatten sich bis zuletzt für andere Kriterien starkgemacht – etwa Einwohnerzahl oder Investitionsbedarf. Ohne Erfolg.
Der Bund hält sich raus – zumindest offiziell
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zeigte sich zufrieden, überließ die Verteilung aber den Ländern. Er wolle sich nicht einmischen, sagte er in Kiel – und drängte gleichzeitig auf Tempo. Denn der Bund will das neue Ausführungsgesetz bald auf den Weg bringen. Dafür braucht es eine einheitliche Linie unter den Ländern.
Ob das Geld gleichmäßig in festen Raten ausgezahlt wird oder abhängig vom Projektfortschritt – das steht noch nicht fest. Auch hier sind weitere Gespräche geplant.
Ein Deal mit altem Muster
Die Entscheidung für den Königsteiner Schlüssel war absehbar – auch wenn sie für Unmut sorgt. Das Verfahren hat Tradition, auch wenn es selten fair erscheint. Schon beim Digitalpakt oder beim Ausbau ganztägiger Bildungsangebote diente der Schlüssel als Grundlage. Immer wieder profitieren dabei die reichen Länder, weil sie eben auch die größten Steuerzahler haben.
Dabei gäbe es Alternativen: 2015 etwa wurden bei einem Infrastrukturprogramm noch Faktoren wie Arbeitslosenquote oder kommunale Kassenkredite berücksichtigt. Diesmal nicht. Warum? Weil die Mehrheit der Länder sich einig war – und jene, die verlieren, keine Sperrminorität hatten.

Schulden machen nach Plan
Neben dem Investitionspaket verständigten sich die Minister auch auf neue Schuldenregeln. Künftig dürfen die Länder gemeinsam 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Krediten aufnehmen – rund 15 Milliarden Euro pro Jahr. Auch hier wird wieder nach Königsteiner Schlüssel verteilt.
Für Schleswig-Holstein bedeutet das eine halbe Milliarde Euro zusätzlichen Spielraum, für Niedersachsen etwa das Dreifache. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Formel inzwischen zur Standardlösung geworden ist – ob sie passt oder nicht.
Das Saarland sieht alt aus
Ein Bundesland, das seit Jahren mit Schulden kämpft, marode Infrastruktur und Abwanderung – und nun gerade einmal 1,05 Milliarden Euro aus dem großen Topf bekommt. In Bremen ist die Lage ähnlich. Beide Länder gelten als besonders abhängig von Bundeshilfen. Doch in dieser Verteilrunde bleibt ihnen kaum mehr als ein symbolischer Betrag.
Die Frage, ob das noch gerecht ist, steht im Raum. Aber wer stellt sie laut? In Kiel hielt man sich zurück – zu groß war die Erleichterung über eine Einigung.
Wie geht es jetzt weiter?
Die Ministerpräsidenten sollen im Juni final entscheiden. Bis dahin könnten noch kleinere Korrekturen an der Verteilung vorgenommen werden – denn die zugrunde liegenden Zahlen stammen von 2019. In den kommenden Wochen wird der Königsteiner Schlüssel mit aktuellen Daten neu berechnet. Viel ändern dürfte das aber nicht.
Die eigentliche Herausforderung liegt ohnehin woanders: Wird das Geld schnell genug verbaut? Oder versickert es in Planungsprozessen, Genehmigungen und Kompetenzgerangel? Der Bund hat seine Milliarden zugesagt. Jetzt sind die Länder am Zug.
Das könnte Sie auch interessieren: