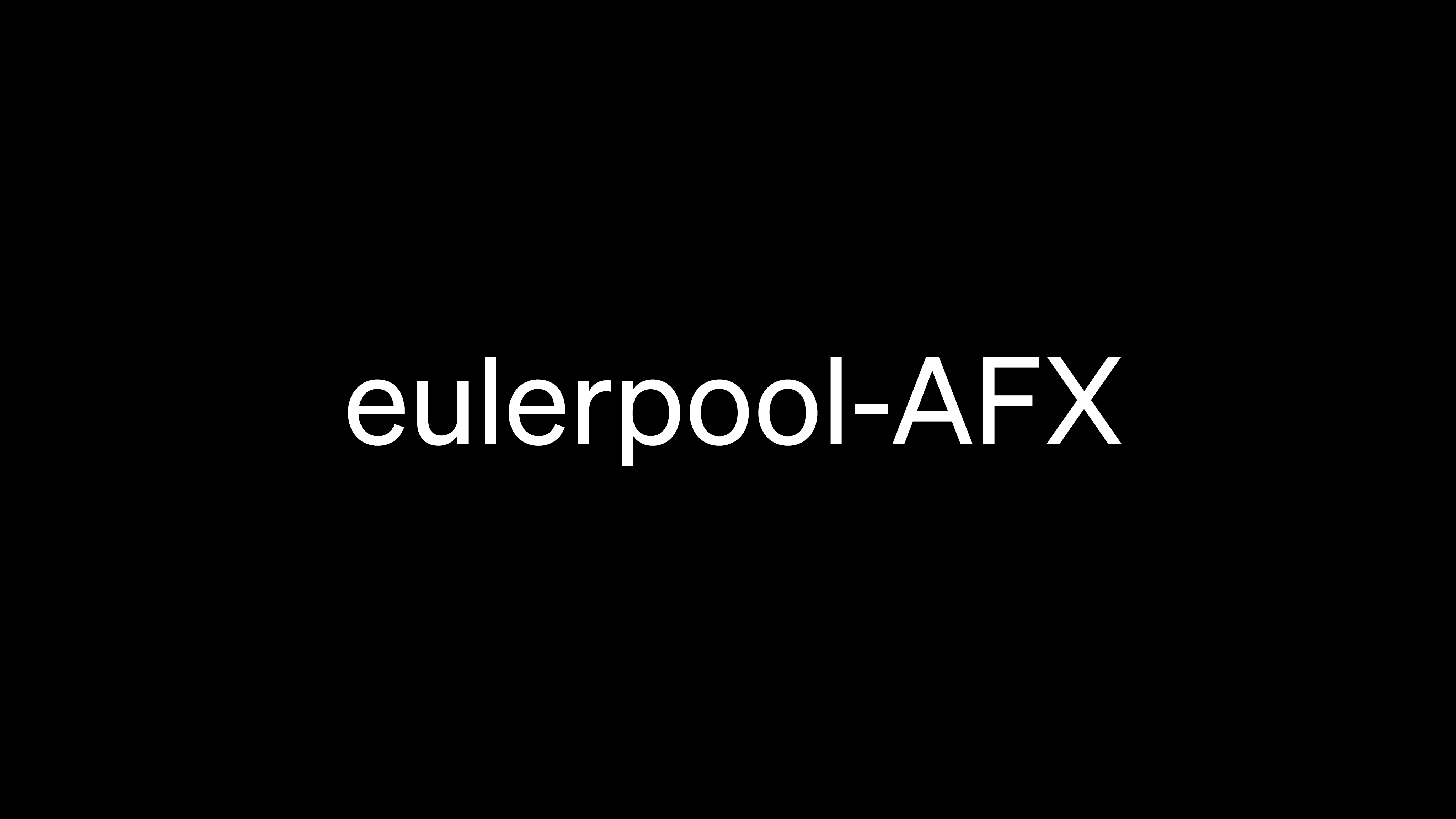Die Serie der Klimarekorde bleibt ungebrochen: Nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hat der März 2024 als zehnter Monat in Folge die weltweiten Temperaturen der jeweiligen Vorjahre übertroffen. Der vergangene März stellte damit die vorherigen Rekordhalter in den Schatten und markiert den wärmsten März seit Beginn der detaillierten Klimaaufzeichnungen im Jahr 1950.
Laut Samantha Burgess, der stellvertretenden Direktorin von Copernicus, manifestiert sich mit dem März 2024 die kontinuierliche Abfolge von Temperaturrekorden, die sowohl die Luft- als auch Meeresoberflächentemperaturen betreffen. Im diesjährigen März verzeichnete die Lufttemperatur an der Erdoberfläche im Durchschnitt einen Wert von 14,14 Grad Celsius. Dieser liegt damit 0,73 Grad über dem mittleren Wert des Vergleichszeitraums von 1991 bis 2020 und übertrifft den bisherigen Rekord-März aus dem Jahr 2016 um 0,10 Grad.
Die Daten zeigen außerdem eine bedeutende Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitraum zwischen 1850 und 1900; der März 2024 war in dieser Hinsicht 1,68 Grad wärmer. Der kumulative Durchschnitt der globalen Temperatur der letzten zwölf Monate (April 2023 bis März 2024) erreichte ebenfalls einen Höchststand, indem er den vorindustriellen Durchschnitt um 1,58 Grad überstieg. Der Klimawandeldienst betont jedoch, dass dies nicht zwangsläufig ein Scheitern des Pariser 1,5-Grad-Ziels bedeutet, da Langfristtrends entscheidend sind, und projiziert bei unverändertem Trend das Erreichen dieser kritischen Schwelle für das Jahr 2033.
Für das Jahr 2023 legt Copernicus dar, dass es mit einer globalen Erwärmung von 1,48 Grad über dem präindustriellen Niveau das wärmste Jahr seit 1850 war. Burgess hatte bereits zu Jahresbeginn angenommen, dass die Temperaturen im Jahr 2023 wahrscheinlich wärmer gewesen sind als zu jedem Zeitpunkt in den vergangenen 100.000 Jahren. Zudem rangiert Europa im vergangenen Jahr auf dem zweiten Platz der wärmsten Jahre seit Aufzeichnungsbeginn.
Die EU-Institution Copernicus stützt sich auf umfangreiche und vielfältige Datenquellen wie Satelliten, Schiffe, Flugzeuge und weltweite Wetterstationen, um regelmäßige Berichte über Oberflächentemperaturen, Meereis und Niederschläge bereitzustellen – ein komplexes Unterfangen, das durch hochentwickelte Computeranalysen ermöglicht wird.