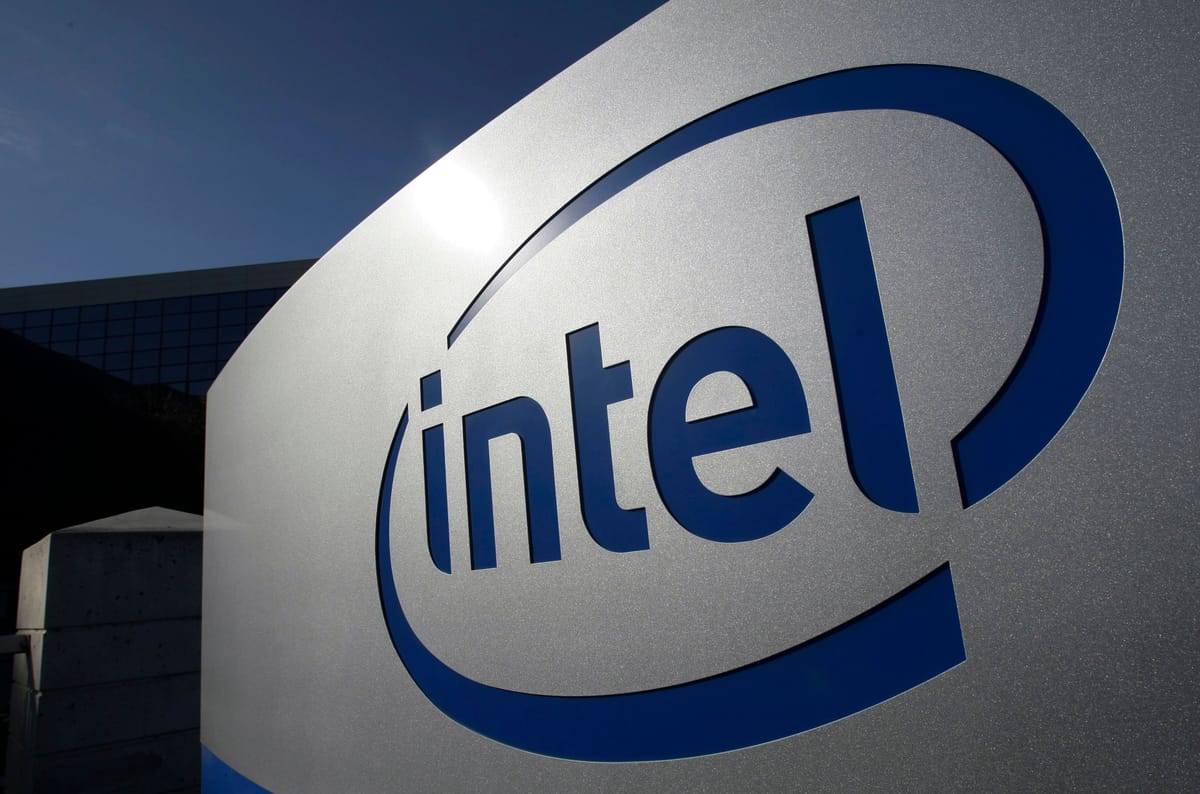Washington greift direkt zu
Die US-Regierung ist neuer Großaktionär bei Intel. Handelsminister Howard Lutnick bestätigte, dass der Staat rund 9,9 Prozent der Anteile hält.
Finanziert wurde der Einstieg nicht über klassische Kauforder an der Börse, sondern über Subventionen: 8,9 Milliarden Dollar an Fördergeldern werden in Aktien umgewandelt, gut zwei Milliarden hatte Intel bereits vorab kassiert. Stimmrechte gibt es keine – das Weiße Haus kann also nicht ins operative Geschäft hineinregieren.
Trumps Handschrift
Der Deal trägt klar die Handschrift von Donald Trump. Sein Vorgänger Joe Biden setzte auf direkte Subventionen für die Halbleiterbranche, um die Produktion in den USA hochzufahren.
Trump lehnt das Modell ab und bevorzugt Beteiligungen sowie Zölle. Die Intel-Anteile verschaffen ihm Einfluss ohne Mitsprache im Vorstand – und zugleich die Möglichkeit, die Chipproduktion politisch enger an die USA zu binden.
Eine Option auf fünf weitere Prozent hat sich Washington ebenfalls gesichert. Der Staat könnte in den kommenden fünf Jahren zum Preis von 20 Dollar je Aktie nachlegen, falls Intel weniger als 51 Prozent an seinem Fertigungsgeschäft hält.
Euphorie an der Börse
Die Wall Street reagierte prompt: Intels Aktie sprang um 5,5 Prozent auf 24,80 Dollar, im nachbörslichen Handel sogar über 25 Dollar. Anleger werten die Staatsbeteiligung als Signal, dass Intel nicht fallengelassen wird. Doch nicht alle sind überzeugt.
„Das ist ein Vertrauenssignal, aber keine operative Wende“, analysierte Halbleiter-Experte Stacy Rasgon bei CNBC. Neue Kunden, so Rasgon, gewinne man damit nicht.
Ein Konzern im Rückwärtsgang
Intel, einst das Synonym für Prozessoren, ist seit Jahren ins Hintertreffen geraten. Im Geschäft mit Chips für künstliche Intelligenz dominiert mittlerweile NVIDIA, bei PC-Prozessoren und Server-Chips schwindet die Profitabilität.
Intels Versuch, als Auftragsfertiger in die Fußstapfen von TSMC zu treten, läuft bislang schleppend. Selbst das große Fabrikprojekt in Magdeburg wurde auf Eis gelegt.
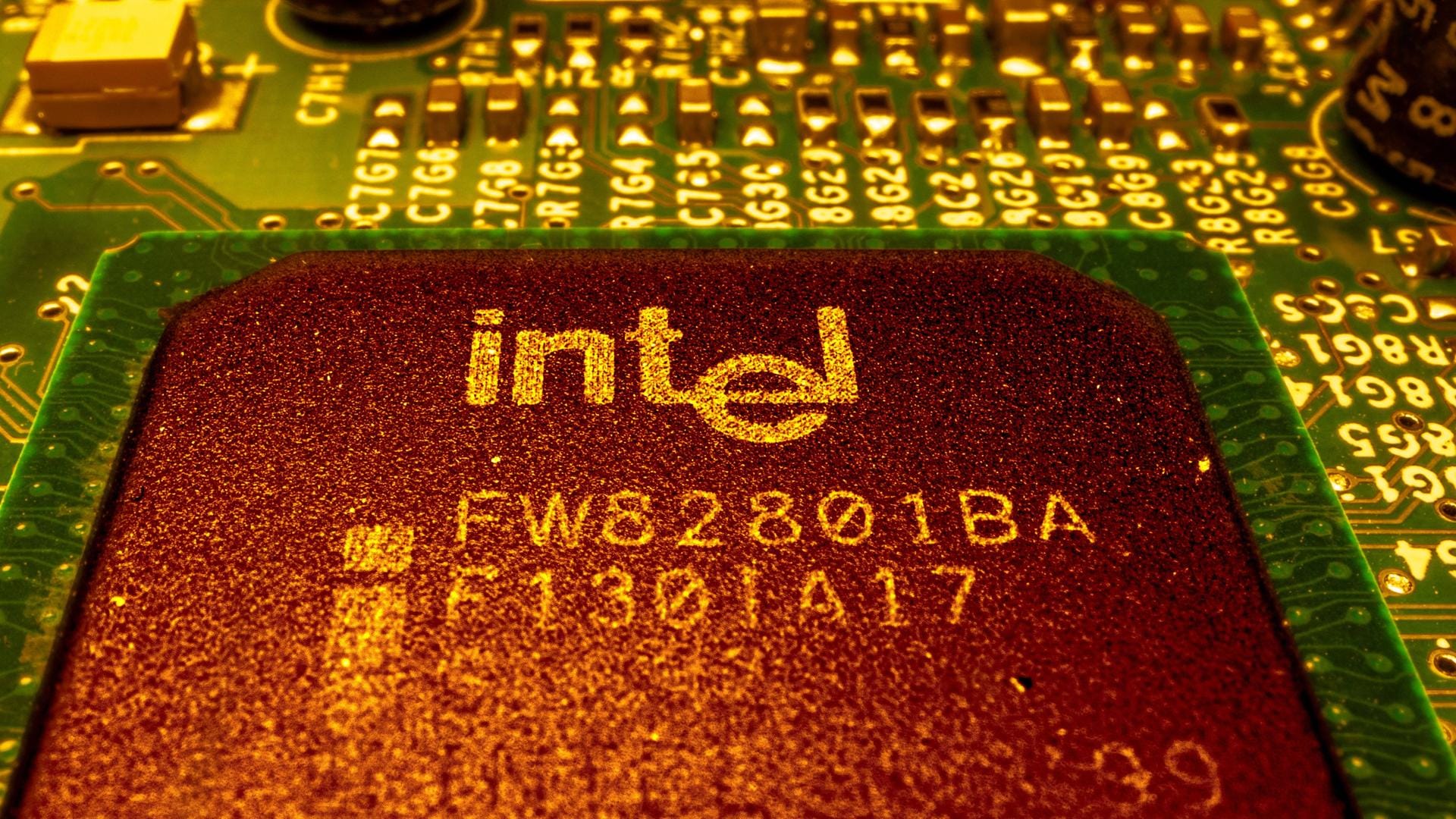
Strategische Achillesferse
Der Staatseinstieg ist auch Ausdruck geopolitischer Sorgen. Die USA wollen ihre Abhängigkeit von Taiwan reduzieren, wo der Großteil moderner Chips produziert wird. Angesichts der Spannungen mit China gilt das als riskant. Doch neue Werke im Westen brauchen Jahre, bis sie laufen – und verschlingen Milliarden.
Die Beteiligung an Intel ist deshalb weniger eine Finanzspritze als eine Versicherung: Washington kauft sich direkten Zugriff auf die heimische Chipproduktion, bevor der nächste Krisenfall eintritt.
Goldene Zeiten oder Staatskonzern?
Trump hat schon bei der Übernahme von US Steel durch Nippon Steel eine „goldene Aktie“ eingeführt, die Washington ein Mitspracherecht bei Standortentscheidungen sichert. Mit Intel geht er noch einen Schritt weiter.
Für Intel selbst ist die Beteiligung eine Atempause, keine Lösung. Das Unternehmen muss beweisen, dass es technologisch wieder aufschließen kann. Sonst droht aus dem einstigen Taktgeber der Branche ein Unternehmen zu werden, das nur noch mit staatlicher Rückendeckung überlebt.
Das könnte Sie auch interessieren: