Marco Rubio ließ keinen Raum für Zweifel. Kaum hatte der US-Außenminister in Ottawa das Wort, legte er los – scharf, unmissverständlich, fast angriffslustig. Die Europäische Union habe „kein Recht zu bestimmen, was internationales Recht sei oder wie die Vereinigten Staaten ihre nationale Sicherheit verteidigen“, erklärte er. Ein Satz, der in seinem Tonfall nicht nur irritierte, sondern den Kern eines Konflikts offenlegte, der weit über juristische Spitzfindigkeiten hinausgeht.
Washington sieht Selbstverteidigung – Europa sieht einen Präzedenzfall
Auslöser des Streits sind mindestens 19 US-Militärschläge auf Schiffe in der Karibik. Nach Angaben aus Washington transportierten die Ziele Drogen, Waffen oder Personal der sogenannten „Narkoterroristen“. 76 Menschen kamen dabei ums Leben. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sprach bereits von „Völkerrechtsbruch“. Die Operationen hätten ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates und außerhalb eines unmittelbaren Selbstverteidigungsfalls stattgefunden – und damit außerhalb jeder rechtmäßigen Grundlage.
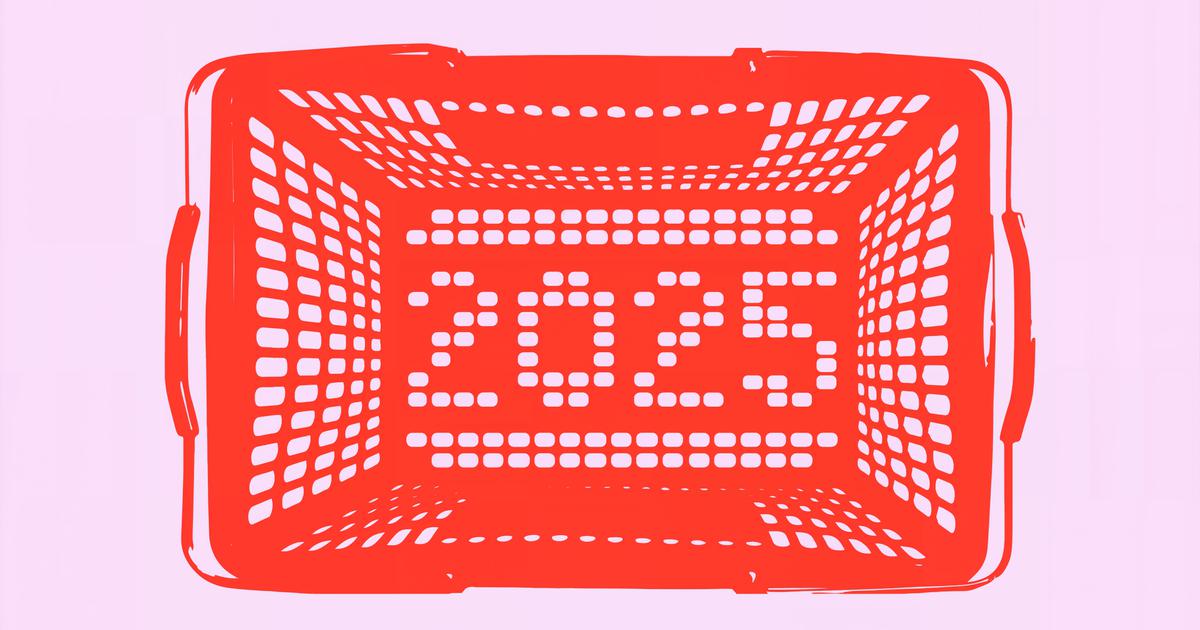
Rubio hingegen führt Artikel 51 der UN-Charta an, der Staaten das Recht auf Selbstverteidigung zugesteht. Die USA handelten nicht nur legal, sondern auch moralisch, sagte er. Und mehr noch: Die Europäer sollten „Beifall spenden“ statt Kritik üben.
Es war ein Satz, der im Saal für hörbaren Unmut sorgte. Denn was Washington als notwendigen Schlag gegen transnationale kriminelle Netzwerke verkauft, sehen europäische Diplomaten schlicht als gefährlichen Alleingang, der zukünftige Normen im internationalen Recht verwässert – und anderen Staaten Tür und Tor für ähnliche Interpretationen öffnet.
UN-Experten sprechen von „außergerichtlichen Hinrichtungen“
Während die USA den Angriff als Polizeitaktik im globalen Kampf gegen organisierte Kriminalität darstellen, sind die Einschätzungen aus New York unmissverständlich: Unabhängige UN-Experten stuften die Angriffe als „außergerichtliche Hinrichtungen“ ein, da sie in internationalen Gewässern, ohne Gerichtsverfahren und ohne unmittelbare Bedrohungslage erfolgt seien.
Kolumbien reagierte prompt. Präsident Gustavo Petro setzte die operative Zusammenarbeit seiner Sicherheitskräfte mit den USA aus – ein symbolischer, aber deutlich spürbarer Dämpfer für die amerikanische Drogenbekämpfungsstrategie in der Region.
Risse im Westen – und ein ungewöhnlich lauter Ton aus Washington
Der brüchige Konsens innerhalb der G7 kommt zu einer Zeit, in der die geopolitischen Spannungen ohnehin wachsen. Ob Ukraine, Südchinesisches Meer oder Naher Osten: Bisher galt der Westen als abgestimmt, wenn auch nicht immer einig. Doch mit Rubios Auftritt in Ottawa wurde ein Ton gesetzt, der an frühere, unilaterale Episoden amerikanischer Machtpolitik erinnert.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas reagierte kühl. Militärische Einsätze seien nur durch ein Mandat des UN-Sicherheitsrats oder durch unmittelbare Selbstverteidigung gedeckt – alles andere untergrabe die internationale Ordnung. Es war eine deutliche, aber sachliche Antwort, die einen Kern widerspiegelt: Europa sieht sich als Hüter einer regelbasierten Weltordnung. Washington sieht sich zunehmend als Akteur, der nicht auf Zustimmung wartet.

London schweigt – Washington dementiert
Besonders brisant: Laut mehreren Medienberichten soll Großbritannien den nachrichtendienstlichen Austausch mit den USA vorübergehend eingeschränkt haben – ein Schritt, der in der „Five Eyes“-Gemeinschaft nahezu beispiellos wäre. Rubio wies diese Berichte zurück. Offizielle Bestätigungen aus London gibt es bislang nicht.
Sollte sich der Vorgang jedoch bewahrheiten, wäre der Schaden weit größer als eine diplomatische Verstimmung. Es wäre ein Warnsignal, dass selbst engste Verbündete die amerikanische Interpretation von Bedrohung und Recht zunehmend skeptisch sehen.
Die offene Frage: Wer bestimmt die Regeln?
Der Streit in Ottawa zeigt, wie fragil die Koordination westlicher Außenpolitik geworden ist. Während die USA argumentieren, ihr nationales Sicherheitsrecht müsse global Anwendung finden, pochen die Europäer darauf, dass internationale Normen nicht nach Belieben gedehnt werden dürfen.
Es ist ein Streit, der nicht in einer Pressekonferenz endet. Denn wenn eine Supermacht das Gewaltmonopol des UN-Sicherheitsrats zu relativieren beginnt, gerät ein Fundament ins Wanken, das seit dem Zweiten Weltkrieg für Stabilität sorgen sollte.
Rubios Satz von der EU, die „uns nicht sagt, wie wir uns verteidigen sollen“, könnte sich noch als Wendepunkt erweisen. Nicht, weil Europa den USA tatsächlich Vorgaben macht – sondern weil Washington erstmals in Jahren offen zeigt, dass es sich von solchen Erwartungen immer weniger gebunden fühlt.




