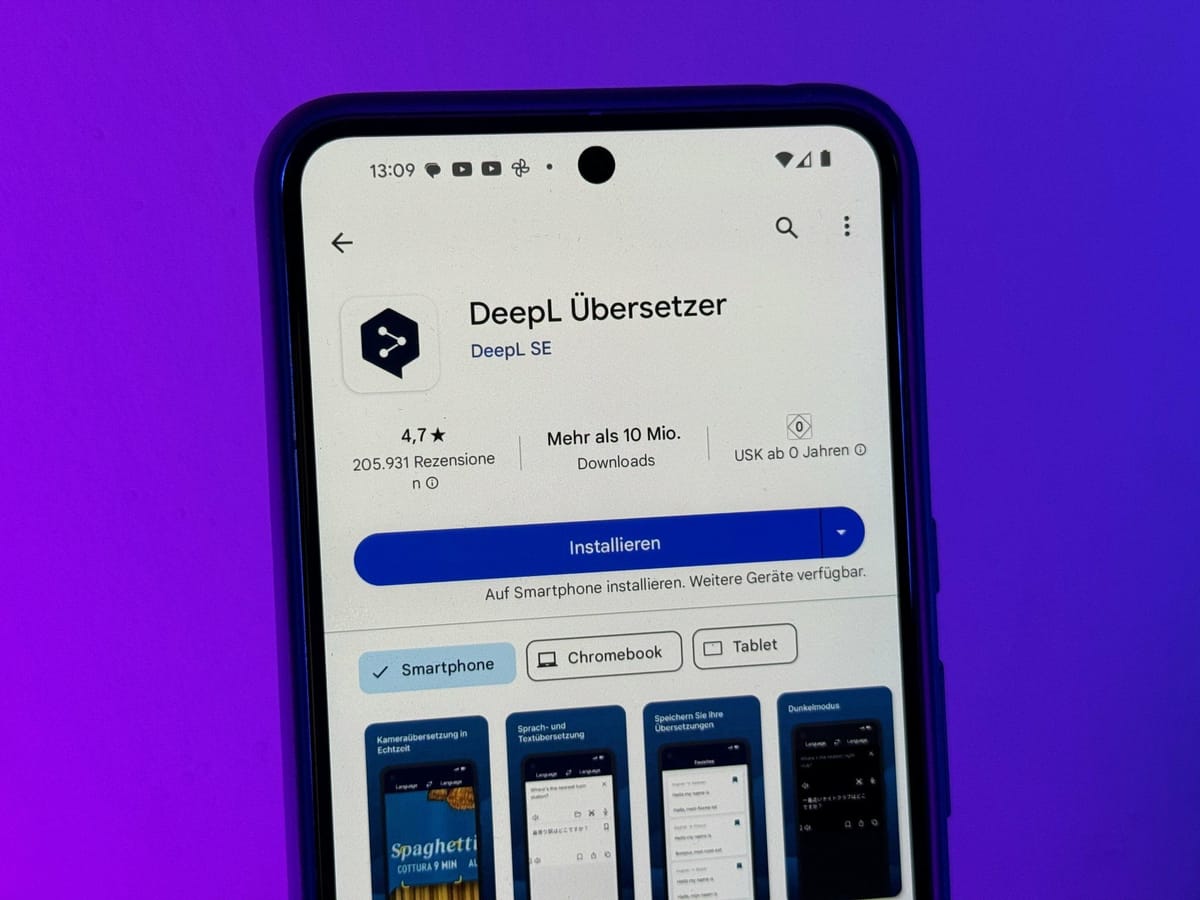Sprachen verbinden – und Märkte auch
Als Jarek Kutylowski 1996 ohne ein Wort Deutsch an einem Paderborner Gymnasium steht, ahnt er nicht, dass seine Sprachlosigkeit einmal zum Fundament eines Milliardenunternehmens werden würde.
Heute leitet er mit DeepL einen der weltweit führenden KI-Übersetzungsdienste – und verfolgt damit einen Plan, der weit über Grammatik und Syntax hinausgeht.
Das Geschäftsmodell: weniger Buzzwords, mehr Spezialisierung
Während Microsoft und OpenAI ihre Sprachmodelle zu Alleskönnern aufblasen, bleibt DeepL beim Kern: professionelle Übersetzungen. 2017 aus dem Vorgängerprojekt Linguee heraus gegründet, setzt das Unternehmen auf eigens entwickelte neuronale Netze – keine GPT-Lizenz, keine Cloud-Abhängigkeit aus den USA.
Stattdessen: Rechenzentren in Island, Schweden und Finnland. Das klingt nicht nach Silicon Valley – ist aber gerade in Europa ein Verkaufsargument.

Datenschutz verkauft sich gut
Die Nachfrage kommt vor allem aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor. Der Vertrag mit der Techniker Krankenkasse, neue Kunden in Slowenien und eine frische Vertriebspartnerschaft mit Bechtle zeigen: DeepL setzt auf Institutionen, denen Datenschutz wichtiger ist als der neueste KI-Hype. Für viele Behörden ist das entscheidend – sie dürfen gar keine US-Modelle nutzen.
IPO in Arbeit – aber keiner spricht darüber
Offiziell hält sich DeepL bedeckt. Kein Kommentar zu Zahlen, kein klares Statement zum Börsengang. Doch intern tut sich einiges. Ein 75-Millionen-Dollar-Kredit wurde aufgenommen, ein neuer Finanzchef mit Börsenerfahrung aus New York sitzt bereits im Boot.
Die Wahrscheinlichkeit, dass DeepL 2026 an die Börse geht, liegt laut Pitchbook bei 80 Prozent. Ob in Frankfurt oder an der Nasdaq – noch offen.
Die Konkurrenz: groß, laut, schnell
ChatGPT, Google Translate, Meta – die Liste der Rivalen ist lang. Google übersetzt 243 Sprachen, DeepL gerade mal 36. Doch genau hier liegt der Unterschied: DeepL will keine Massen bedienen, sondern Qualität liefern.

Für CEO Kutylowski ist Sprache individuell, geprägt vom Kontext – nicht nur ein Feature in einer riesigen Software.
Neue Produkte, neue Märkte
Mit DeepL Write Pro und DeepL Voice stellt das Unternehmen gerade zwei neue Tools vor: ein KI-Schreibassistent und eine Simultanübersetzung für Videokonferenzen.
Letztere läuft laut Kutylowski bei Kundengesprächen in Japan „einfach mit“. Das Ziel: mehr Integration in den Arbeitsalltag – und damit stärkere Bindung an Geschäftskunden.
Privatkunden? Nett, aber nicht wichtig
Die Google-Suchanfragen nach „DeepL Translator“ sind zuletzt um fast 30 Prozent gesunken. Gleichzeitig steigt die Nutzung von ChatGPT als Übersetzungshilfe. Für Investor Florian Schweitzer kein Problem:
„DeepL hat sich längst vom Verbrauchermarkt verabschiedet.“
Wachstum gibt’s jetzt im B2B-Bereich – dort, wo Budgets größer und Abhängigkeiten tiefer sind.
2022 schrieb DeepL ein kleines Minus von knapp 290.000 Euro. Für ein Unternehmen mit Tech-Fokus ist das beinahe irrelevant.
„In der KI zählt Wachstum, nicht Profitabilität“, sagt Tech-Analyst Julian Riedlbauer.
Laut Schätzungen lag der Umsatz 2024 bereits bei bis zu 200 Millionen Euro – Tendenz steigend.
Der Standortvorteil: Europa
Was als technischer Nachteil wirkt – keine US-Infrastruktur, keine globalen Cloud-Verträge – wird plötzlich zum geopolitischen Argument. Europas digitale Abhängigkeit von den USA ist politisch unerwünscht, aber faktisch Realität. DeepL kann hier mit echter Unabhängigkeit punkten – und nutzt das zunehmend offensiv in der Kommunikation.
Was bleibt: leise Größe statt lauter Show
Kutylowski gibt selten Interviews, meidet den Medienzirkus – aber baut im Hintergrund konsequent weiter. Neue Produkte, neue Märkte, neue Strukturen. Und womöglich bald ein Börsengang. Was einst in einem Paderborner Klassenzimmer begann, könnte bald an den internationalen Finanzplätzen für Aufsehen sorgen.
Der IPO wäre dann nicht nur ein wirtschaftlicher Schritt – sondern ein Statement: Europa kann KI. Auch ohne OpenAI.
Das könnte Sie auch interessieren: