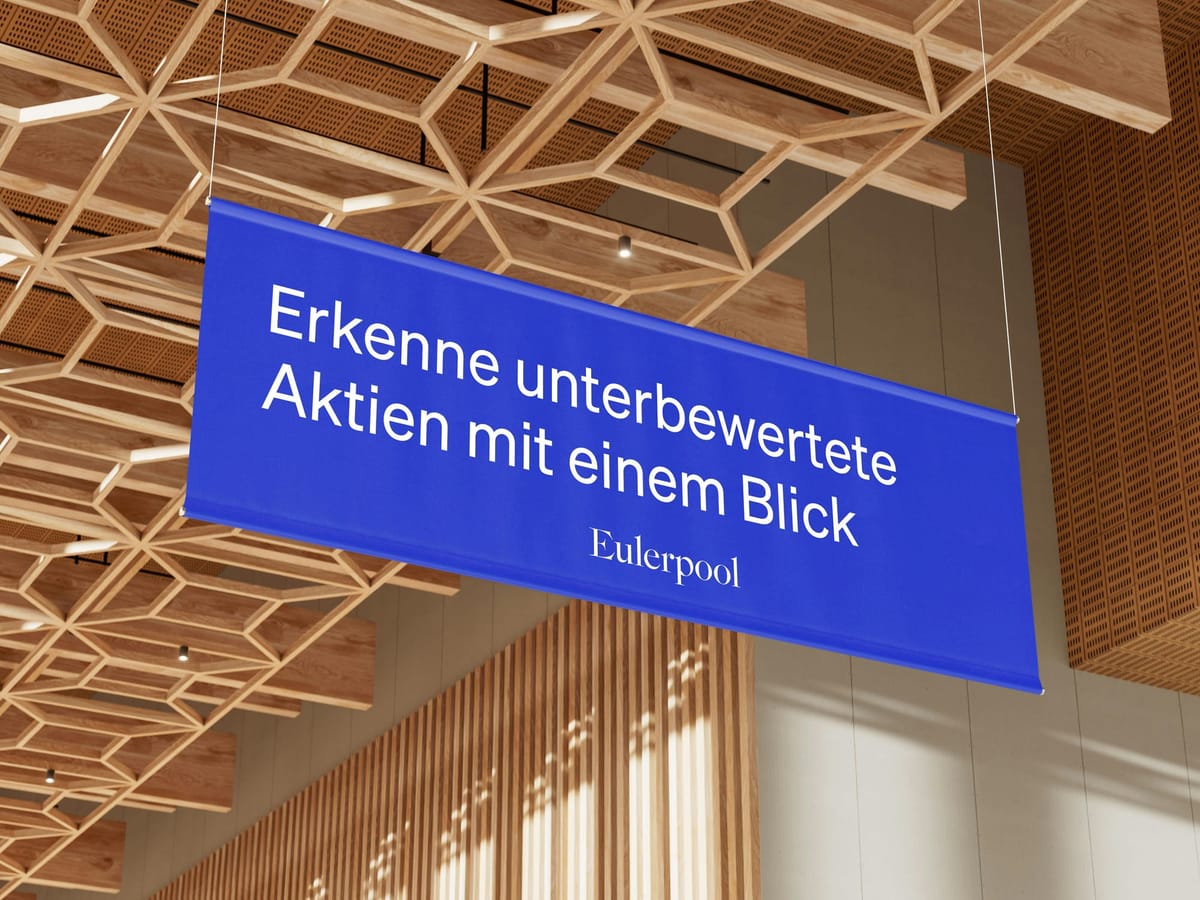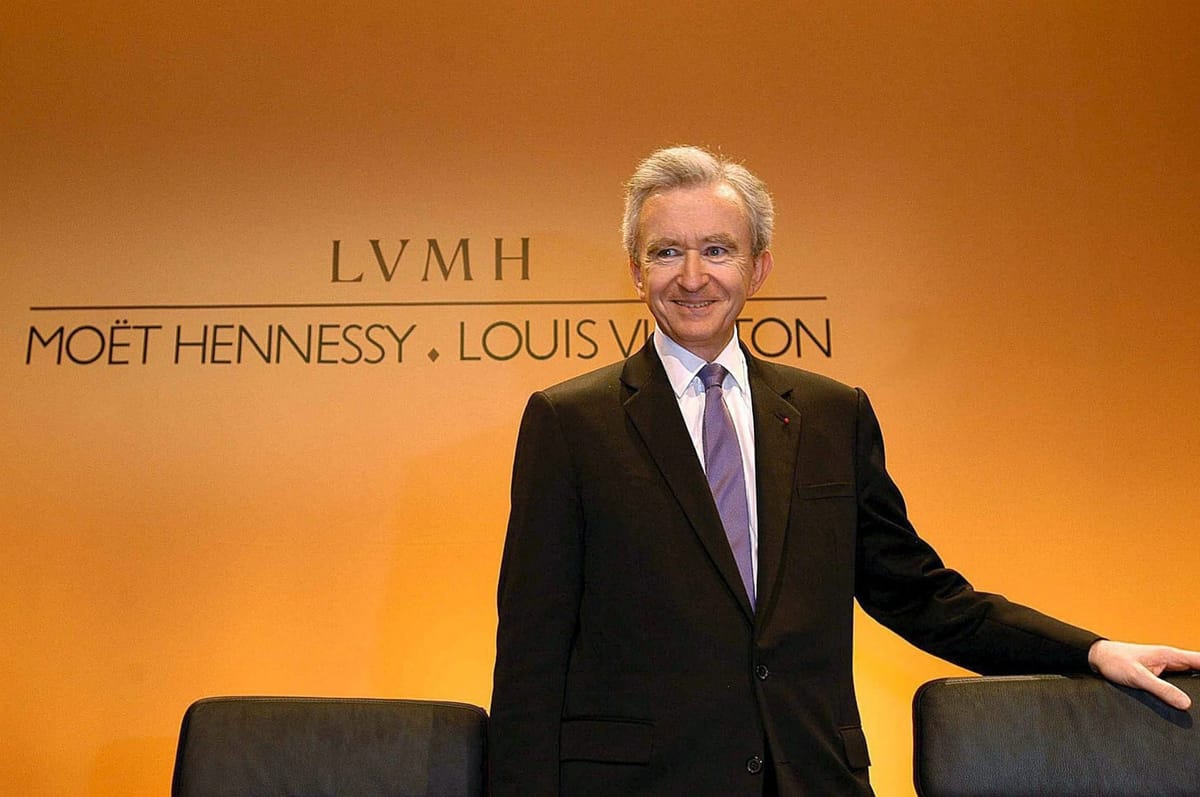Ein Quartal der Gegensätze
Kaum eine andere Branche versteht es so meisterhaft, Skandale in Stil zu verwandeln, wie die Luxusindustrie. Am Dienstag präsentierte LVMH starke Zahlen – und ließ damit eine Nachricht, die anderen Konzernen den Atem geraubt hätte, fast beiläufig verblassen: Die EU-Kommission verhängte hohe Strafen gegen mehrere Modehäuser wegen jahrelanger Preisabsprachen, darunter die LVMH-Tochter Loewe.
Während Gucci, Chloé und Loewe nun gemeinsam rund 157 Millionen Euro zahlen müssen, stieg die LVMH-Aktie um mehr als zwölf Prozent. Ein paradoxes Bild: Juristisch ein Tiefschlag, wirtschaftlich ein Befreiungsschlag.

Wettbewerbshüter decken Preisabsprachen auf
Nach Erkenntnissen der EU-Kommission hatten die drei Modehäuser ihren Vertriebspartnern untersagt, von empfohlenen Verkaufspreisen abzuweichen. Rabattaktionen wurden stark eingeschränkt, manche Produkte durften nur in bestimmten Zeiträumen verkauft werden. Ziel: Die Preisdisziplin in Boutiquen und Online-Shops sollte gewahrt bleiben – um den luxuriösen Schein auch im Preisschild zu konservieren.

Diese Praktiken liefen laut Brüssel über Jahre hinweg – bei Gucci und Loewe von 2015 bis 2023. Erst unangekündigte Razzien in Italien, Spanien und Frankreich brachten das System ans Licht. Die Kommission wertet das Vorgehen als klaren Verstoß gegen EU-Wettbewerbsrecht: „Dieses Verhalten führt zu höheren Preisen und geringerer Auswahl für Verbraucher“, so die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Teresa Ribera.
Kooperation lohnt sich – zumindest finanziell
Alle drei Marken gestanden ihre Verstöße ein und erklärten, die Praktiken inzwischen eingestellt zu haben. Wer kooperiert, zahlt weniger: Gucci und Loewe profitierten von einer 50-prozentigen Reduktion der Strafen, Chloé immerhin von 15 Prozent. Am Ende steht Gucci mit 119,7 Millionen Euro am Pranger, Loewe mit 18 Millionen Euro und Chloé mit 19,7 Millionen Euro.
Für LVMH bleibt das ein überschaubarer Schaden – ein Bruchteil dessen, was der Konzern an einem guten Handelstag an Börsenwert gewinnt.
Anleger feiern trotz Fehlverhalten
Dass Investoren über die Strafen hinwegsehen, ist bezeichnend für den Zustand der Luxusbranche. Die Marke LVMH scheint unantastbar – selbst dann, wenn rechtliche Verfehlungen öffentlich werden. Denn was zählt, sind Gewinn, Wachstum und Symbolkraft. Und die Quartalszahlen liefern genau das: starke Margen, Rekordumsätze und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Luxusartikeln in den USA und Asien.
Die Strafe? Für viele nur eine Fußnote – oder, wie ein Analyst es formuliert: „Ein Imageproblem mit eingebautem Goldrand.“
Moralischer Makel oder Marktmacht?
Der Fall wirft eine unbequeme Frage auf: Wie weit darf Luxus gehen, um exklusiv zu bleiben? Die künstliche Preisstabilität, die EU-Ermittler nun zerschlagen wollen, war letztlich Teil der DNA dieser Marken – ein Schutz vor der Banalisierung des Besonderen.
Doch wenn „Exklusivität“ bedeutet, Verbraucherrechte zu umgehen, droht das Geschäftsmodell zu kippen. Der moralische Konflikt zwischen Preishoheit und Wettbewerb wird die Branche noch beschäftigen.
Glanz mit Schatten
LVMH steht einmal mehr dort, wo es der Konzern gewohnt ist – an der Spitze. Der Luxusmarkt feiert die Zahlen, die Börse jubelt, die Strafen verpuffen. Doch hinter der glänzenden Fassade steht ein System, das auf Kontrolle, Knappheit und Inszenierung basiert.
Die Frage ist nur, wie lange sich dieser Widerspruch halten lässt, bevor Luxus zum Synonym für Machtmissbrauch wird.