Die Entscheidung könnte zum Wendepunkt für Europas größte Airline werden. Lufthansa prüft, ihre Bodenverkehrsdienste in Frankfurt und München auszulagern – und damit eines der letzten großen Premiumsegmente des Konzerns auf Kosten der Beschäftigten zu reformieren.
Nach Informationen aus Unternehmenskreisen erwägt die Fluggesellschaft, die Abfertigungsdienste in eine eigene Gesellschaft mit günstigeren Tarifverträgen zu überführen. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter: rund 4.000, davon etwa 2.500 in Frankfurt und 1.500 in München.
Offiziell gibt sich der Konzern zugeknöpft. Auf Anfrage wollte ein Sprecher die Überlegungen „weder bestätigen noch dementieren“. Doch aus dem Umfeld heißt es, die Fachabteilungen hätten den Auftrag, die Kostenmodelle „konkret durchzurechnen“.
Sparen am Boden – um in der Luft zu überleben
Hinter den nüchternen Zahlen steckt ein strategischer Kraftakt. Lufthansa Airlines, die Kern- und Premiummarke des Konzerns, steckt tief im Umbau. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete sie einen Verlust von 307 Millionen Euro, davon entfielen allein 274 Millionen Euro auf die Hauptmarke Lufthansa.
Seit Monaten arbeitet eine interne Taskforce mit über 150 Mitarbeitern an einem Turnaround-Programm, das bis 2028 Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro bringen soll. Die Kostenstruktur steht dabei im Zentrum.
In der Investorenpräsentation zum Kapitalmarkttag Ende September taucht der Bereich „Ground Ops“ prominent unter dem Schlagwort „Cost Excellence“ auf – ein Euphemismus für Kostensenkung.
Das Problem: Ein externer Dienstleister bezahlt rund 20 Prozent weniger Lohn als Lufthansa selbst. Der Reiz aus Sicht des Managements liegt auf der Hand. „Gleiche Arbeit – günstiger bezahlt“, fasst es ein Verdi-Funktionär bitter zusammen.

Verdi in der Zwickmühle
Für die Gewerkschaft Verdi ist die Situation heikel – fast paradox. Denn der Branchentarifvertrag, auf den Lufthansa nun spekuliert, stammt aus Verdis eigener Feder. Nach jahrelangen Verhandlungen war er Anfang 2024 geschaffen worden, um die fragmentierte Tariflandschaft der Bodendienstleister zu vereinheitlichen.
Heute könnte genau dieser Vertrag zur Hebelwirkung für Kostensenkungen bei der Lufthansa werden.
Marvin Reschinsky, Verdi-Verhandlungsführer für Lufthansa, versucht den Spagat. „Bezogen auf Arbeitszeiten und Schutzrechte ist der Branchentarifvertrag sogar besser als der alte“, sagt er. „Aber bei den Endgehältern und der Altersvorsorge liegen Welten dazwischen.“
Ein Branchenwechsel in die neue Gesellschaft wäre arbeitsrechtlich kaum zu verhindern. Das Arbeitsrecht kennt für solche Fälle den Begriff des Teilbetriebsübergangs – juristisch sauber, für Beschäftigte aber oft existenzbedrohend.
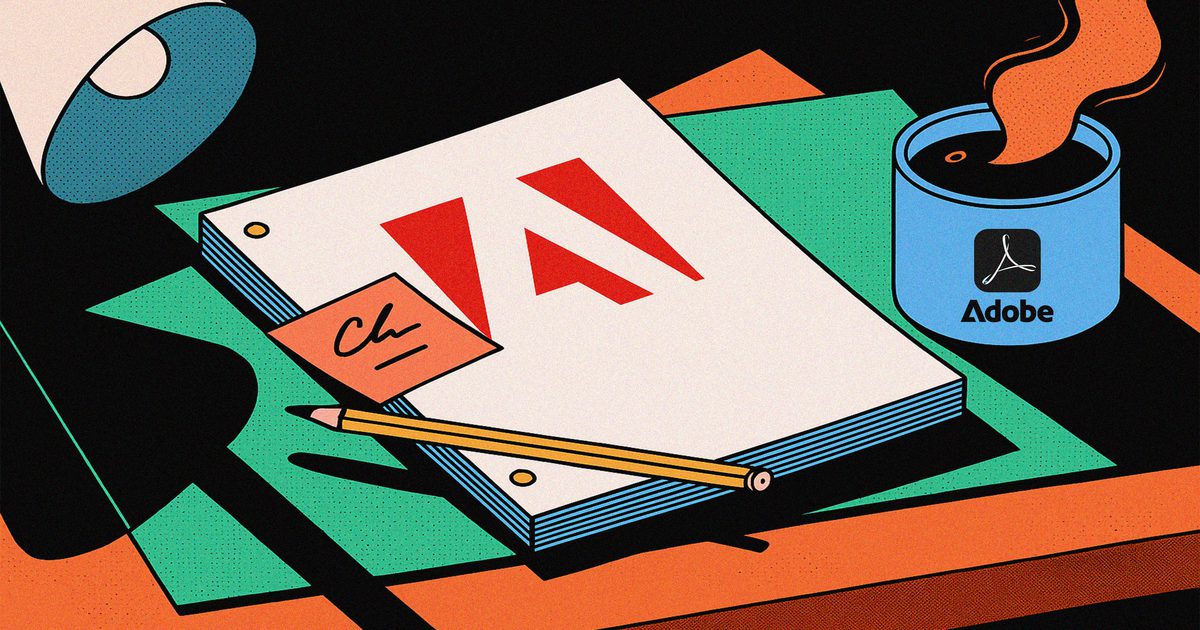
Frankfurt und München im Fokus – zwei Drehkreuze, ein Risiko
Das Einsparpotenzial ist enorm – und das Risiko ebenso. Die Lufthansa testet das Modell bereits in München: Dort übernahm die Airline Anfang 2025 den Dienstleister Swissport Losch und integrierte ihn als externen Abfertigungspartner.
Ziel: eine stabilere Abfertigung, nachdem es im Vorjahr zu massiven Verspätungen gekommen war. Doch in Wahrheit diente das Münchener Modell offenbar als Pilotprojekt für eine größere Umstrukturierung.
Sollte Frankfurt folgen, wäre die Kernmarke Lufthansa künftig nur noch Auftraggeber – nicht mehr Arbeitgeber – für ihr eigenes Bodenpersonal. Gewerkschaftlich und organisatorisch wäre das ein Bruch mit der bisherigen Konzernkultur.
Spannungen zwischen Management und Belegschaft
In der Belegschaft wächst die Nervosität. Nach der jüngsten Streichung von 4.000 Stellen – überwiegend in Deutschland – droht nun eine weitere Erosion der internen Strukturen.
Ein Mitarbeiter beschreibt die Stimmung gegenüber InvestmentWeek so: „Viele fragen sich, ob die Lufthansa überhaupt noch eine Premium-Airline sein will oder nur noch ein Hochglanz-Label für Outsourcing.“
Auch innerhalb des Konzerns tun sich Brüche auf. Während die Bodenmitarbeiter um ihre Zukunft bangen, fordern die Piloten höhere Unternehmensbeiträge zur Altersversorgung. Nach einer erfolgreichen Urabstimmung drohen Streiks. Das Management lehnt die Forderung als „nicht tragbar“ ab.
„Es entsteht der Eindruck, dass die Piloten ihre Interessen durchsetzen – und die Bodenleute den Preis zahlen“, sagt ein Mitarbeiter aus der Verwaltung. „Diese Spaltung frisst Vertrauen.“
Das Dilemma des Managements
Für Lufthansa-Chef Jens Ritter ist das Dilemma offenkundig: Einerseits muss der Konzern effizienter werden, um international wettbewerbsfähig zu bleiben – insbesondere gegen Billigmarken und staatlich subventionierte Golf-Airlines. Andererseits riskiert er, die soziale Balance im Unternehmen zu zerstören.
Mit einem Umsatz von über 35 Milliarden Euro (2024) ist die Lufthansa solide aufgestellt – aber ihre Margen sind dünn. Die Bodenprozesse zählen zu den teuersten im europäischen Vergleich.
Analysten sehen die geplante Auslagerung daher als unvermeidlich. „Lufthansa muss die Kosten um jeden Preis senken, um ihr Premiumversprechen zu halten“, sagt Luftfahrtanalystin Bettina Rödel vom Deutschen Institut für Wirtschaft. „Aber sie spielt dabei mit einem der empfindlichsten Güter: der Loyalität ihrer Belegschaft.“
Arbeitsrechtlich sauber – moralisch umstritten
Juristisch ist der Schritt kaum angreifbar. Der Betriebsrat kann einen Teilbetriebsübergang nicht verhindern, Streiks wären rechtlich unwirksam.
Moralisch jedoch ist der Vorgang schwer zu verteidigen. Ausgerechnet jene Belegschaft, die während der Pandemie mit Kurzarbeit und Gehaltsverzicht den Betrieb aufrechterhielt, soll nun dem Sparzwang geopfert werden.

„Das ist klassischer Kostenkapitalismus“, kommentiert Arbeitsrechtler Ralf Döring von der Universität Hamburg. „Die Airline will Premiumservice bieten – aber zum Preis von Discountlöhnen.“
Ein Symbol für die neue Luftfahrt-Ökonomie
Was bei Lufthansa passiert, ist symptomatisch für eine Branche im Wandel. Airlines weltweit lagern zunehmend aus – vom Catering über die Wartung bis zum Check-in. Das Ziel ist überall dasselbe: Fixkosten senken, Flexibilität erhöhen, Risiko verlagern.
Doch mit jedem ausgelagerten Job verschiebt sich auch die Kultur. Lufthansa war lange stolz auf ihre integrierte Wertschöpfungskette – auf das, was sie von Ryanair und EasyJet unterschied.
Die Frage ist nun: Wie viel Lufthansa steckt noch in der Lufthansa, wenn Kernbereiche in Tochtergesellschaften verschwinden?
InvestmentWeek-Fazit: Zwischen Effizienz und Identität
Die geplante Auslagerung ist mehr als eine Personalmaßnahme – sie ist ein Gradmesser dafür, wie weit Europas einstiger Premium-Carrier bereit ist, seine Identität ökonomischen Zwängen zu opfern.
Kurzfristig könnte die Maßnahme Gewinne stützen und Investoren beruhigen. Langfristig aber droht der Konzern, das Vertrauen seiner Belegschaft – und damit den Kern seiner Marke – zu verlieren.
Die Lufthansa steht an einem Scheideweg: Entweder sie bleibt Arbeitgeberin mit Verantwortung – oder sie wird zur reinen Managementgesellschaft, die Service outsourct und Haltung outsourct gleich mit.



