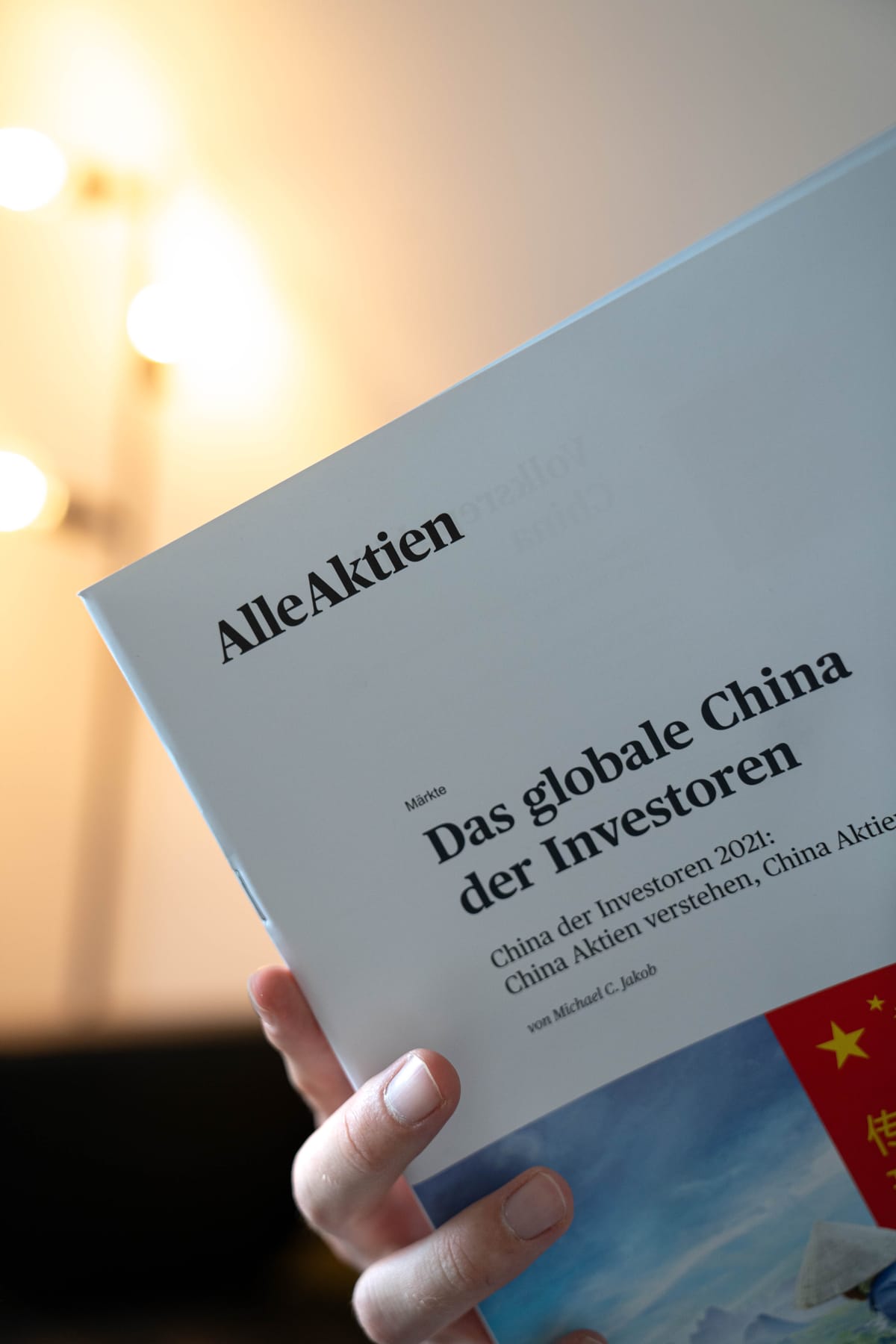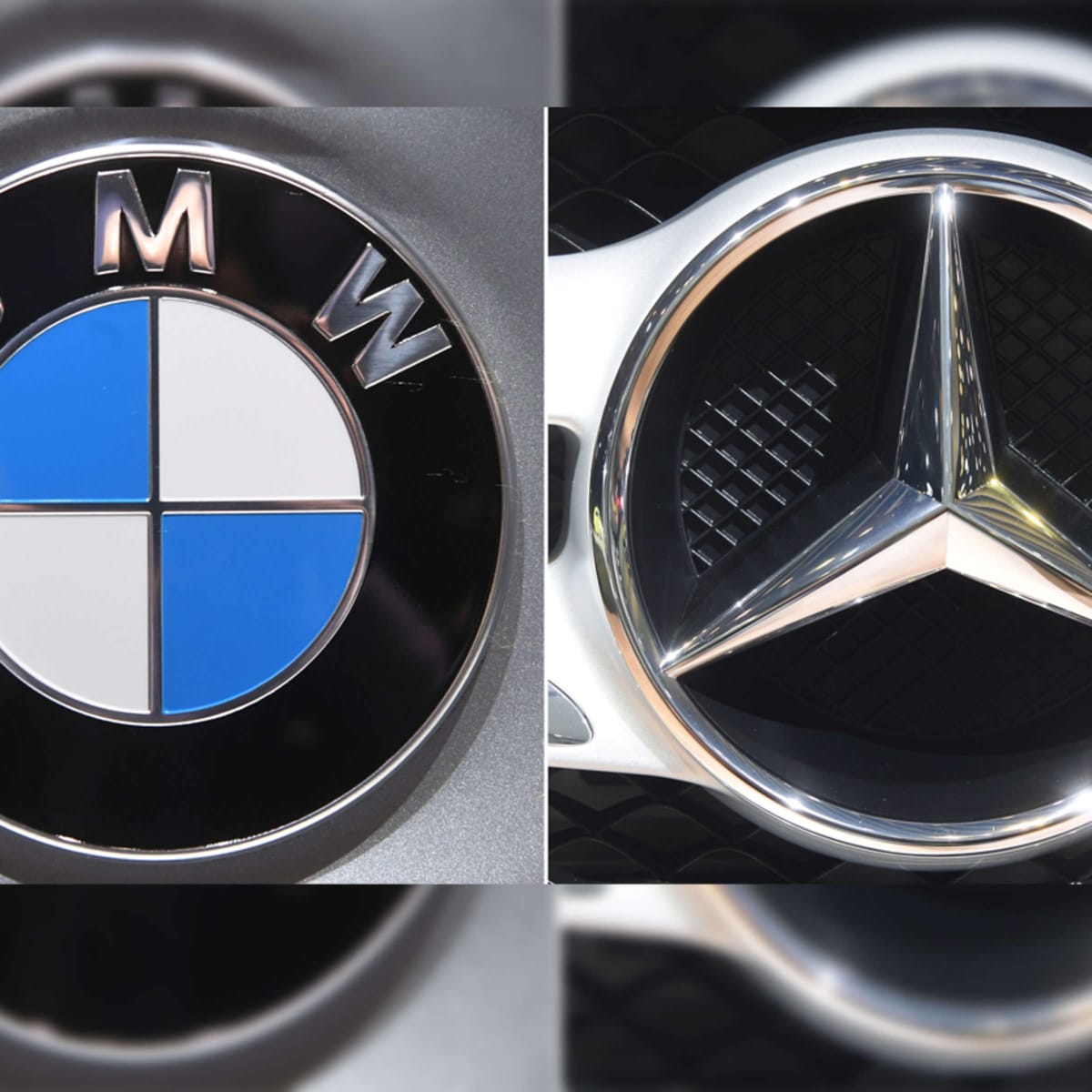Krise, Kurswechsel, Kooperation
Noch vor wenigen Jahren hätte man es für ausgeschlossen gehalten. BMW und Mercedes, die beiden ewigen Rivalen, sollen künftig gemeinsame Motoren einsetzen – und mittelfristig womöglich ganze Antriebssysteme teilen.
Was lange wie ein PR-GAU klang, könnte für beide Seiten zur strategischen Notwendigkeit werden. Denn der Autokrise zum Trotz brauchen beide Hersteller eines ganz dringend: verlässliche Margen.
Und die gibt’s im Moment nicht mit elektrischen Luftschlössern, sondern mit funktionierenden, effizienten Verbrennern.
Källenius Kehrtwende
Anstoß für die Gespräche war ausgerechnet Mercedes-CEO Ola Källenius, der sich einst als Totengräber des Verbrenners inszenierte. 2030, so sein damaliger Plan, sollte Schluss sein mit dem klassischen Antrieb.
Stattdessen: volle Kraft in Richtung Elektromobilität, flankiert von einer Technologiepartnerschaft mit dem chinesischen Geely-Konzern.
Heute klingt das wie aus der Zeit gefallen. Mercedes braucht dringend neue Motoren – und will sie nicht mehr aus China beziehen. Zu riskant, zu wenig leistungsfähig, zu politisch aufgeladen.
Die Strategie wackelt, der Absatz ebenfalls: Das erste Halbjahr 2025 war das schwächste seit Beginn der Coronakrise. Källenius weiß: Ohne neue, moderne Verbrenner wird es eng. Also holt er Hilfe – von der Konkurrenz.
BMW-Motoren für Mercedes-Benz
Laut Insidern soll BMW ab 2027 zunächst Vierzylindermotoren an Mercedes liefern, produziert im österreichischen Werk Steyr. Perspektivisch ist sogar eine Ausweitung auf Getriebe und komplette Antriebsstränge denkbar.
Technisch ist das kein Selbstläufer – die Motoren müssten angepasst, Komponenten harmonisiert werden. Doch die Grundlagen stimmen.

BMW-Chef Oliver Zipse, ein notorischer Verbrenner-Realist, zeigte sich nach anfänglicher Skepsis offen. Er erkennt offenbar das Potenzial: Ein stabiler Abnehmer für über eine Million Motoren pro Jahr, Planungssicherheit für das Steyrer Werk, Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich – und ein Imagegewinn, wenn selbst Mercedes BMW-Motoren für gut genug hält.
Was früher ein Tabu war, ist heute Vernunft
Noch vor wenigen Jahren galten Motoren als Heiligtum der Marke. BMW war stolz auf seine Reihen-Sechszylinder, Mercedes auf seine AMG-Aggregate. Heute zählen Stückzahlen, Skalierung, Plattformeffekte.
Wer überleben will, muss Synergien schaffen. Die Zeiten, in denen jede Schraube ein Markenversprechen war, sind vorbei – auch weil die Elektromobilität diese Differenzierung zunehmend auflöst.
Dass zwei deutsche Premiumhersteller ihre Triebwerke künftig teilen, ist also kein Zeichen von Schwäche – sondern das Resultat wirtschaftlicher Realität.
Lesen Sie auch:
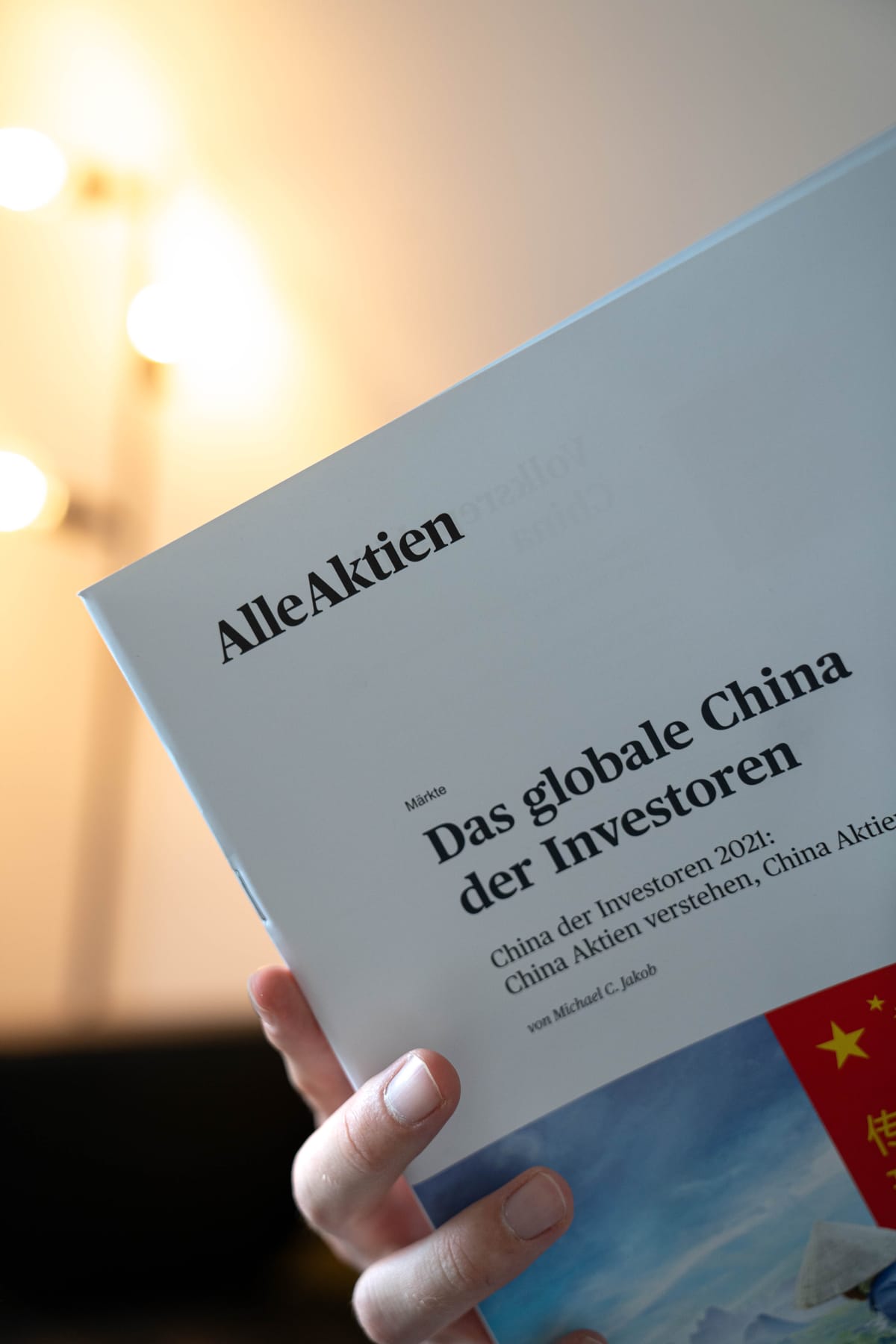
Warum gerade jetzt?
Die Lage zwingt zur Bewegung. BMW hat Produktionskapazitäten, Mercedes hat Bedarf. Gleichzeitig verschiebt sich der Markt: Plug-in-Hybride verkaufen sich besser als erwartet, reine Elektroautos geraten unter Druck, nicht zuletzt wegen der abflauenden Förderung und der schleppenden Ladeinfrastruktur.
Für die nächsten zehn Jahre wird der Verbrenner nicht verschwinden – und wer ihn beherrscht, bleibt konkurrenzfähig.
Ein zweiter Faktor: China. Mercedes bezieht bislang Teile seiner Motoren von Geely. Doch geopolitische Spannungen und wachsender Widerstand in den USA gegen chinesische Bauteile machen den Konzern nervös. Eine Allianz mit BMW wäre da nicht nur technisch, sondern auch politisch cleverer.
Leise Skepsis in München
Ganz überzeugt ist man in München offenbar nicht. Besonders bei der Getriebe-Frage zögert BMW. Der Premiumhersteller ist langjähriger Kunde von ZF Friedrichshafen, die Integration mit Mercedes-Systemen wäre aufwendig. Außerdem will Zipse vermeiden, dass BMW-Ingenieurskunst als Zulieferleistung für Stuttgart missverstanden wird.
Doch auch bei BMW spürt man den Druck. Die Allianz mit Mercedes könnte dafür sorgen, dass das Werk Steyr nicht irgendwann stillläuft. Und: Sie verschafft dem Konzern ein Mitspracherecht in einer Phase, in der sich die Antriebslandschaft neu sortiert.
Schon einmal gescheitert
Ganz neu ist die Idee übrigens nicht. Bereits 2009 hatten die damaligen Konzernchefs Zetsche (Mercedes) und Reithofer (BMW) über eine Motorenallianz nachgedacht.
Damals scheiterte das Projekt an kulturellen Differenzen – und am Ingenieurstolz beider Seiten. Das Bild vom „Kuschel-Igel“, der seine Stacheln nicht einziehen kann, machte damals die Runde.
Heute ist die Lage eine andere. Die Stacheln sind stumpfer geworden. Die Realität drückt.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern. Die Aufsichtsräte müssen zustimmen, auch juristisch sind Kartellfragen zu klären. Doch im Kern steht eine Wahrheit: Wenn selbst Mercedes und BMW bereit sind, ihr Allerheiligstes zu teilen, dann zeigt das, wie radikal sich die Spielregeln in der Branche gerade ändern.
Das könnte Sie auch interessieren: