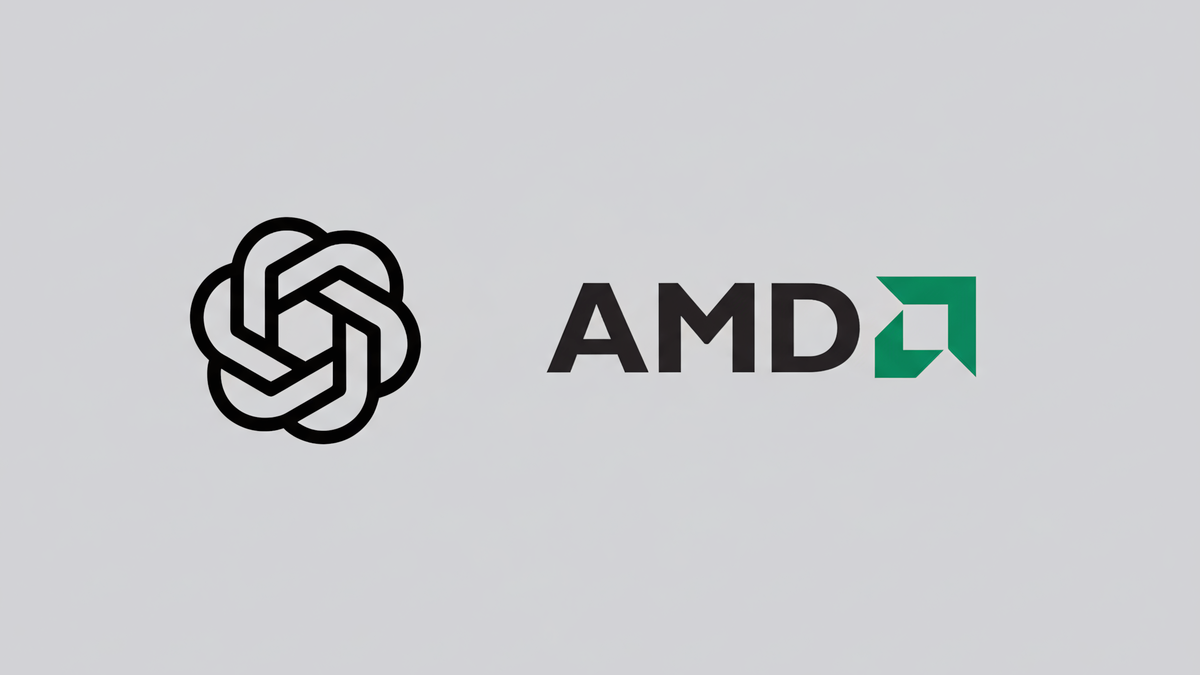Der Ort, an dem die Musik verstummte
Der Weg zum Feld ist staubig, der Wind trocken. Wo 2023 beim Supernova-Festival gefeiert wurde, stehen heute Fotos in Reih und Glied. Shani Louk blickt von einer der Tafeln herab, jung, wild, vertraut. Diese Gesichter sind in Israel überall – an Brücken, Bushaltestellen, Flughäfen. Sie erinnern daran, wie rasch ein sicher geglaubtes Leben in Gewalt kippen kann.
Nahal Oz: Das Haus, das stehen blieb – und der Glaube, der fiel
Addi Gan El Cherry zeigt auf die erneuerte Haustür. Davor: die wenigen Meter, die Terroristen am Morgen des 7. Oktober brauchten. Drinnen: der Schutzraum, die Stahltür, unter der Benzin in den Raum lief.
Soldaten kamen im letzten Moment. Das Haus ist repariert. Das Vertrauen nicht. „Wir kannten die Arbeiter aus Gaza“, sagt sie. „Sie tranken Tee bei uns. Später fanden wir Pläne mit unseren Namen.“ Man fühlt: Es ist nicht die Angst geblieben, es ist der Verrat.

Der zweite Krieg: die Deutungsschlacht
Seit dem Angriff ringt Israel auch um Bilder und Worte. Der Krieg in Gaza wird global auf dem Smartphone verhandelt. Die Hamas inszeniert Widerstand, Israel verteidigt sich – und verliert doch oft im Takt der Timelines.
Begriffe wie „Dekolonisierung“ und „Imperialismus“ liefern schnelle Erklärungen, lassen aber den Ausgangspunkt verschwimmen: einen pogromartigen Angriff auf Zivilisten. Der Maßstab, mit dem man Israel misst, ist streng – oft strenger als bei Syrien oder Jemen. Das erklärt nichts, aber es prägt die Stimmung.
Außenpolitik im Umbau: Weniger Pathos, mehr Partnerwechsel
Der erste Reflex nach dem 7. Oktober war westliche Solidarität. Mit der Bodenoffensive wuchs die Distanz. Israel organisiert sich neu: enger mit den USA, pragmatischer mit Indien, nüchterner mit Europa.
Es ist weniger eine Kehrtwende als eine Risikostreuung – in Sicherheit, Energie, Technologie. Man hört das in Ministerien inzwischen ohne Romantik: Niemand will Europa verlieren. Niemand will davon abhängig sein.
Die offene Wunde: 48 Geiseln
An Brücken hängen großformatige Fotos: Gesichter, Vornamen, Alter. In Israel sind die Geiseln allgegenwärtig, international drohen sie aus dem Fokus zu fallen. „Bring them home“ ist kein Slogan, es ist der Takt jeder Kundgebung, jeder Kabinettssitzung. Solange sie nicht zurück sind, bleibt jede politische Formel unvollständig.

Die Justizreform: Wenn die Sicherungen flackern
Die umstrittene Reform verschiebt die Machtbalance zugunsten der Regierung. Für Befürworter ist das Korrektur einer aktivistischen Justiz; für Gegner der Anfang einer Aushöhlung. In Israel ist das keine Theorieschlacht. Es ist Sicherheitsfrage: Vertrauen nach innen bestimmt Handlungsfähigkeit nach außen. Wer Hunderttausende auf die Straße bringt, zeigt Vitalität – und Verwundbarkeit.
Ein Land verliert die Unschuld – wieder
Zeruya Shalev, Schriftstellerin, überlebte 2004 einen Anschlag. Heute fürchtet sie die Erosion im Inneren: „Wenn der Staat, der dich schützen soll, die Regeln beugt, entsteht ein Riss.“ In Haifa erlebt sie das andere Israel: jüdisch-arabische Teams in Kliniken, Universitäten, Cafés. Alltag, der funktioniert – und doch zart bleibt.
Givat Haviva: Die Schule, die Streit aushält
Nördlich von Tel Aviv wohnen Jugendliche arabischer und jüdischer Herkunft gemeinsam im Internat. Hier wird gestritten, geweint, geschwiegen – und weitergeredet.
Die Pädagogen verhindern keine harten Worte; sie kanalisieren sie. Versöhnung ist kein Workshopziel, sondern Folge von Begegnungen, die nicht abbrechen. Wer in der ersten Nacht schlaflos liegt und am zweiten Morgen feststellt, dass der Zimmernachbar nur laut schnarcht, ist einen Schritt weiter als jede Parole.
Tel Aviv, Samstagabend: Verhandeln in Feindesnähe
Auf dem „Hostage Square“ demonstriert die urbane Mitte: Ärzte, Gründer, Studenten, Eltern. Die Schriftstellerin Lizzie Doron sagt: „Mit Feinden redest du nicht aus Zuneigung, sondern weil Leben davon abhängen.“ Ein paar Straßen weiter kurven Autos mit Techno, rufen „Verräter“. Zwei Israels stehen dort einander gegenüber – beide überzeugt, das Land zu retten.
Demografie: Politik mit Familiengröße
Die Zahlen sind klar: Die ultraorthodoxe Bevölkerung wächst am schnellsten. Viele Haredim leisten keinen Wehrdienst, viele sind nicht in den regulären Arbeitsmarkt integriert. Das verschiebt Mehrheiten und Prioritäten.
Schon heute verorten sich laut Umfragen rund 60 Prozent rechts; in der jüngeren Kohorte ist der Anteil höher. Das bedeutet nicht automatisch „weniger Demokratie“ – aber „andere Antworten“. Die liberale Mitte spürt den Druck und liebäugelt mit Auswanderung. Noch ist es kein Exodus. Aber die Gespräche darüber sind real.

Regierungskunst im Schraubstock
Keine stabile Mehrheit kommt ohne Orthodoxe und Nationalreligiöse aus. Das blockiert Entscheidungen, die unpopulär, aber notwendig sind: allgemeine Wehrpflicht, Kerncurricula in religiösen Schulen, Integration in Arbeit statt Dauer-Subvention. Außenpolitik lässt sich verschieben. Innere Reformen nicht.
Was trägt – und was nicht
Militärisch: Die Zerschlagung der Hamas-Infrastruktur ist Voraussetzung, kein Ziel. Politisch: Ein Wiederaufbaumodell für Gaza ohne Rückkehr der Hamas in Machtfunktionen muss her – regional abgestützt, hart kontrolliert, mit Zeitplan. Sozial: Die Aufnahmefähigkeit der israelischen Gesellschaft hängt daran, ob alle Gruppen Pflichten tragen. Die Wehrpflicht für Haredim ist dabei Prüfstein, nicht Detail.
Außen dreigleisig, innen zweispurig
Außen: USA, Indien, Europa – drei Pfeiler, die kombiniert Stabilität geben. Nicht aus Ideologie, sondern wegen Energie, Technologie, Lieferketten. Innen: Zwei Spuren, die parallel laufen müssen – Sicherheit und Rechtsstaat. Wer nur die eine stärkt, überfährt die andere.
Der unbequeme Teil: Palästinensische Perspektive
Ohne glaubwürdige politische Perspektive in den palästinensischen Gebieten wächst der Nachwuchs für Extremisten schneller als jede Barriere. Ob reformierte Autonomiebehörde, regionale Treuhand oder stufenweiser Status unter harter Sicherheitsaufsicht – entscheidend ist, dass es mehr ist als eine Überschrift. Projekte wie Givat Haviva sind Mikrolösungen, aber sie sind Schutzimpfungen gegen die nächste Radikalisierung.
Die Wahrheit, die keiner hören will
Beenden wir den Krieg zu früh, rüstet der Feind nach. Führen wir ihn zu lang, verlieren wir Verbündete, Geiseln – und ein Stück von uns. Es gibt Konflikte, in denen man nicht zwischen gut und schlecht wählt, sondern zwischen schlecht und schlechter. Israels Gegenwart ist genau das.
Schluss – ohne Trost, aber mit Auftrag
Die griechische Tragödie endet selten heiter. Aber sie kennt die Katharsis: Einsicht, die zu Handlung zwingt. Für Israel heißt das: außen hart, innen ehrlich. Wehrpflicht für alle. Schulen, die neben Talmud auch Mathe und Englisch liefern. Eine Justiz, die politisch legitimiert und doch unabhängig bleibt. Eine Gaza-Strategie, die Sicherheit nicht mit Stille verwechselt. Und der Mut, mit Widerwilligen zu verhandeln, wenn Leben davon abhängen.
Die Zumutung bleibt: Israel muss gleichzeitig gewinnen und sich zügeln. Verhandeln, während es kämpft. Innen reparieren, was außen verteidigt werden soll. Alles andere wäre bequem – und falsch.