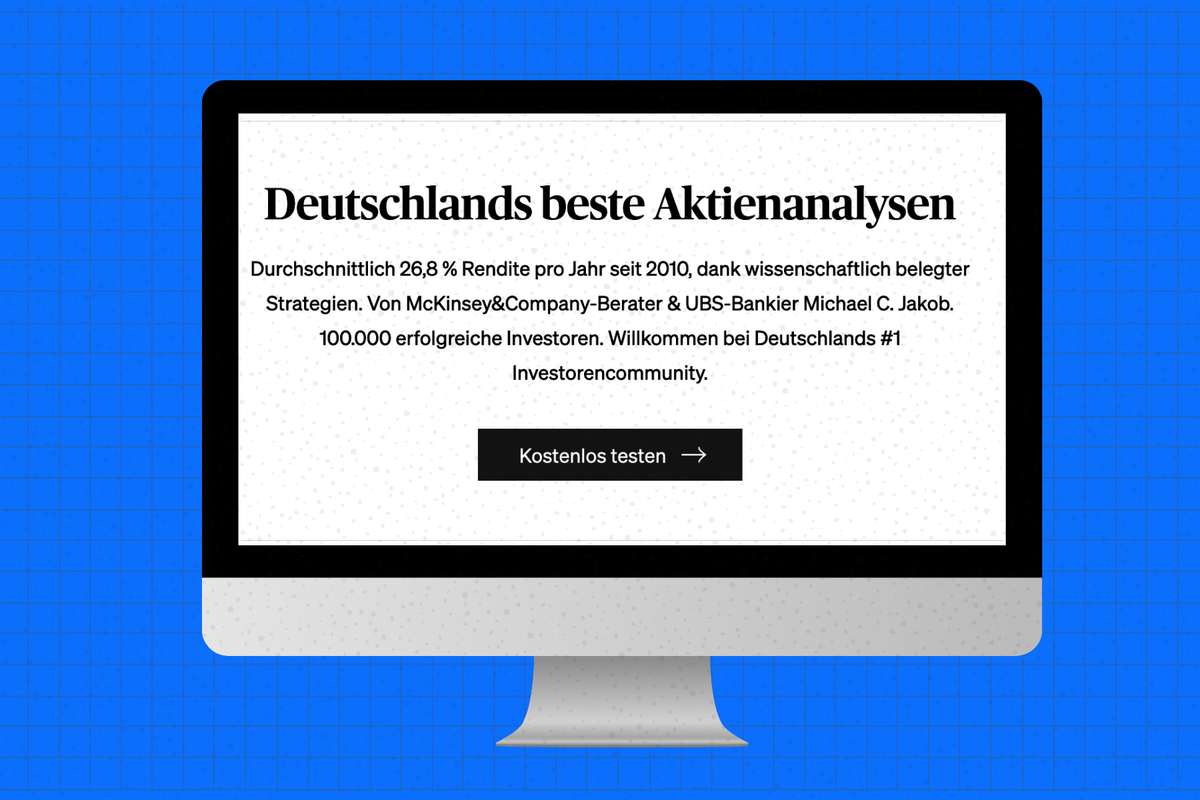Europas Wettbewerbsfähigkeit bricht weg
Es ist ein Satz, der in seiner Wucht kaum übertroffen werden kann: „Europa begeht industriellen Selbstmord.“ Mit diesen Worten kommentiert Stephen Dossett, Chef der Ineos-Tochter Inovyn, den Rückzug seines Unternehmens aus Deutschland. Zwei Werke im nordrhein-westfälischen Rheinberg werden geschlossen, 175 Arbeitsplätze stehen vor dem Aus. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen, doch eines ist jetzt schon klar: Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die ohnehin angeschlagene Chemieindustrie in Deutschland – und ein Symptom eines viel tieferliegenden Problems.

Die Gründe für das Aus benennt Dossett unverblümt: explodierende Energiepreise, hohe CO₂-Abgaben und fehlender Zollschutz gegen billige Konkurrenzprodukte aus Asien. Europäische Hersteller würden so systematisch aus dem Markt gedrängt, während Wettbewerber in den USA und China dank günstiger Energie und laxer Klimavorgaben Produktionsvorteile genießen. „Das ist nicht nur wirtschaftlicher Irrsinn, das ist ökologische Heuchelei“, kritisiert Dossett.
Chinesische Chemie drängt – deutsche Werke schließen
Was wie eine Standortentscheidung eines einzelnen Konzerns klingt, ist in Wahrheit ein strukturelles Alarmsignal. In Rheinberg produzierte Ineos bisher hochspezialisierte Allyl-Chemikalien für die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Verteidigung und die Automobilbranche. Zudem wird dort Chlor hergestellt – ein Grundstoff, der etwa in Medikamenten oder bei der Abwasseraufbereitung unverzichtbar ist.
Diese Produktion wird nun eingestellt, weil die Betriebskosten in Europa im internationalen Vergleich aus dem Ruder gelaufen sind. Billigimporte aus Asien überschwemmen den Markt – hergestellt oft mit russischem Öl und Gas. Damit sind sie nicht nur günstiger, sondern auch klimaschädlicher. Doch während Brüssel seine Industrie mit immer strengeren Umweltauflagen belegt, gelangen diese Produkte ohne nennenswerte Zölle auf den europäischen Markt.
Das Ergebnis: moderne und effiziente Werke in Europa schließen, während emissionsintensive Anlagen in China weiterlaufen – und globale CO₂-Emissionen steigen.
Immer mehr Schließungen: Die Deindustrialisierung schreitet voran
Ineos ist nicht der erste Konzern, der Konsequenzen zieht. Schon zuvor hatte das Unternehmen seine Standorte im britischen Grangemouth und im belgischen Geel dichtgemacht. Im Sommer folgte die Ankündigung der Schließung eines Werks in Gladbeck, bei dem 279 Arbeitsplätze betroffen sind. Allein am Standort Köln beschäftigt Ineos noch rund 2.500 Menschen – wie lange noch, ist ungewiss.
Auch andere Chemiekonzerne kämpfen ums Überleben. Nach Angaben des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) herrscht in der Branche eine „tiefgreifende Krisenstimmung“. Die Hoffnung auf eine wirtschaftspolitische Wende sei verflogen, warnt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. „Die Industrienation Deutschland hat heftig Schlagseite.“

Politik unter Zugzwang – doch Lösungen bleiben aus
Die Forderungen aus der Industrie sind eindeutig: niedrigere Strompreise, weniger Bürokratie, realistische Regulierung. Doch bisher hat die Bundesregierung weder ein schlüssiges Konzept für wettbewerbsfähige Energiepreise vorgelegt noch eine Antwort auf den zunehmenden Kostendruck gefunden. Stattdessen steigt der CO₂-Preis weiter, und neue Berichtspflichten verschärfen die Bürokratiebelastung.
„Wenn die Politik jetzt nicht handelt, verlieren wir nicht nur Anlagen und Arbeitsplätze. Wir verlieren unsere industrielle Basis“, warnt Große Entrup.
Tatsächlich droht eine Entwicklung, die weit über den Chemiesektor hinausreicht. Denn wenn Schlüsselindustrien wie Chemie und Grundstoffproduktion verschwinden, geraten ganze Wertschöpfungsketten ins Wanken – von der Autoindustrie über die Pharmawirtschaft bis hin zu erneuerbaren Energien.
Ein Standort auf der Kippe
Ineos’ Rückzug aus Rheinberg ist mehr als nur eine Unternehmensentscheidung. Er ist ein Weckruf für eine Industriepolitik, die sich in ihrer eigenen Klimapolitik verheddert hat. Statt ein Level Playing Field zu schaffen, hat Europa eine Wettbewerbsumgebung geschaffen, die heimische Unternehmen bestraft und ausländische Anbieter belohnt.
Die Folgen dieser Strategie werden jetzt sichtbar: Werksschließungen, Arbeitsplatzverluste, technologische Abhängigkeiten – und ein Standort Deutschland, der von Jahr zu Jahr weniger attraktiv wird. Wenn sich daran nichts ändert, werden die Worte von Stephen Dossett bald mehr sein als eine Warnung. Sie könnten zur bitteren Realität werden.