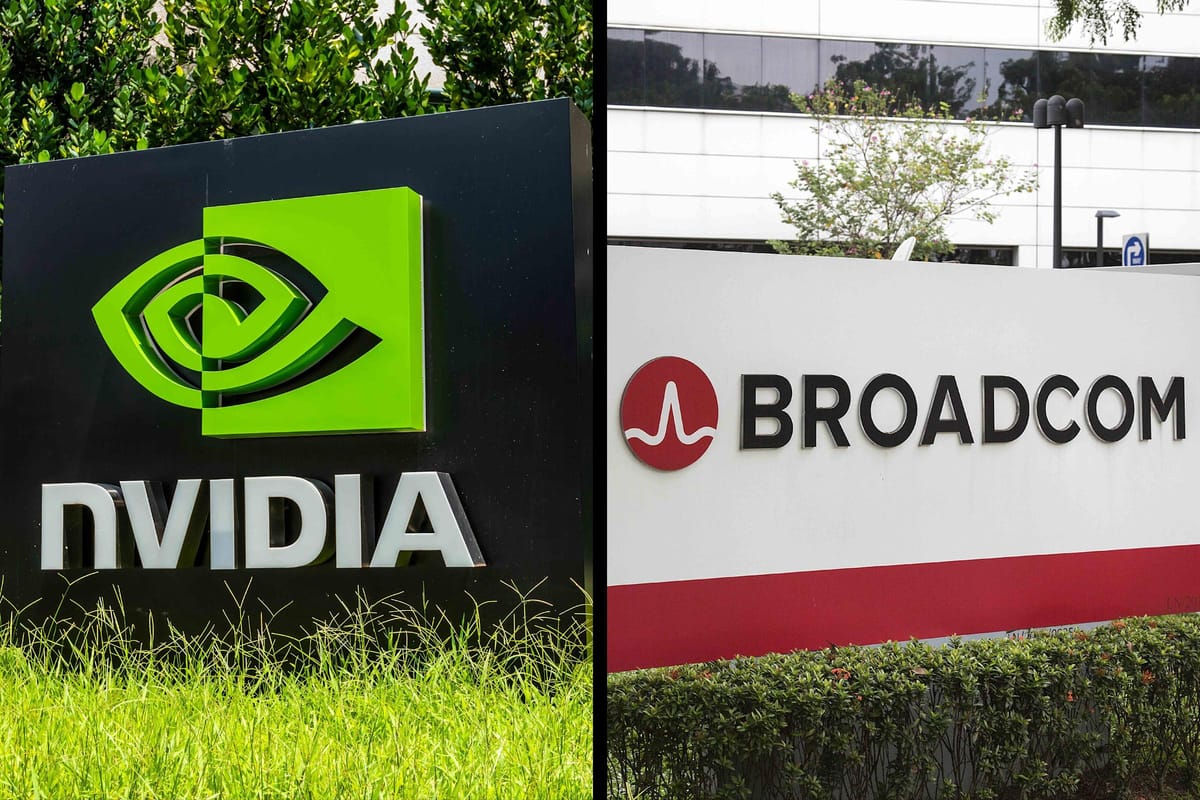Stabile Zahlen – doch der Glanz trübt sich
Der Umsatz steht, das Fundament wackelt. Nach neun Monaten meldet Hella, Tochter des französischen Forvia-Konzerns, einen währungsbereinigten Zuwachs von 0,4 Prozent auf sechs Milliarden Euro. Auf den ersten Blick: solide. Auf den zweiten: eine Bilanz mit Schatten. Denn ausgerechnet dort, wo das Unternehmen jahrzehntelang Maßstäbe setzte – beim Licht –, bricht die Nachfrage ein.
2,7 Milliarden Euro setzte Hella mit Scheinwerfern und Lichtsystemen um, ein Minus von 8,5 Prozent. Der Grund liegt nicht nur in der schwächelnden Fahrzeugproduktion in Europa. In China und den USA liefen gleich mehrere Großprojekte aus – ein Warnsignal für ein Geschäft, das einst das Rückgrat des Unternehmens war.
Radar statt Reflektor – der Wandel im Produktportfolio
Während das klassische Lichtgeschäft schwächelt, florieren andere Sparten. Besonders stark zeigt sich die Nachfrage nach Radarsensoren, die für Fahrassistenzsysteme und teilautonomes Fahren entscheidend sind. In Europa und China läuft das Geschäft mit Fahrzeugzugangssystemen – etwa für schlüssellose Entriegelung – besser als erwartet. Und in China wachsen die Umsätze mit Batteriemanagementsystemen, also Technik für Elektroautos.
Damit verschiebt sich Hellas Schwerpunkt schleichend: weg vom Licht, hin zur Elektronik für das Auto der Zukunft. Die Sensorik wird zum Wachstumstreiber, während die traditionsreiche Lichtsparte zunehmend zur Konjunkturlinse wird – anfällig für Zyklen, abhängig von OEM-Projekten.
Ein Konzern im Umbruch – zwischen Tradition und Zukunft
Seit der Übernahme durch den französischen Zulieferer Forvia (ehemals Faurecia) steht Hella in einer Art strategischem Spagat. Einerseits bleibt das Unternehmen eine Ingenieurmarke mit hohem Qualitätsanspruch – besonders im Lichtdesign, wo deutsche Premiumhersteller seit Jahren auf Hella setzen. Andererseits muss die Integration in den Forvia-Verbund Synergien heben: Einkauf, Forschung, Entwicklung – alles soll effizienter, internationaler, digitaler werden.
Doch Effizienz hat ihren Preis. Die Lichtproduktion gilt als kapitalintensiv, margenarm und abhängig von Einzelaufträgen. In der Elektronik hingegen locken Softwareintegration und Skaleneffekte. Hellas Zukunft hängt also davon ab, ob das Management die Balance findet – zwischen den hochmargigen Zukunftsfeldern und dem schrumpfenden Traditionsgeschäft.
Das Lichtsignal der Branche
Die Zahlen von Hella sind mehr als nur ein Unternehmensbericht – sie spiegeln den strukturellen Wandel der gesamten Zulieferindustrie. Elektronik verdrängt Mechanik, Software ersetzt Gehäuse, Sensoren werden zu den neuen Scheinwerfern der Automobilwelt.
Doch der Übergang ist teuer. Neue Technologien brauchen Investitionen, alte Produktionslinien verlieren an Auslastung. Wer zu spät umschwenkt, riskiert Marktanteile; wer zu früh umstellt, trägt doppelte Kosten. Hella versucht den Spagat mit chirurgischer Präzision – und bisher gelingt er leidlich.
Ausblick: Wenn Stabilität nicht reicht
Firmenchef Bernard Schäferbarthold spricht von einem „robusten Geschäft“. Das stimmt – aber Robustheit ist kein Wachstumsversprechen. Mit einem Umsatz, der stagniert, und einer Kernmarke, die schwächelt, steht Hella an einem Scheideweg. Der Erfolg der kommenden Jahre wird nicht mehr im Licht entschieden, sondern in der Softwarearchitektur, der Sensorleistung und der Energieeffizienz.
Ob der Traditionszulieferer diesen Wandel aus eigener Kraft schafft oder zunehmend im Forvia-Verbund aufgeht, bleibt offen. Fest steht nur: Das Licht, das Hella groß gemacht hat, brennt weiter – aber es flackert.