Warum der letzte verbliebene Quick-Commerce-Anbieter erneut Geld aufnehmen muss
Flink hat sich nach dem Rückzug von Gorillas und Getir als einziger verbliebener Lieferdienst für Lebensmittel in Minuten behauptet. Doch die Marktführerschaft schafft keine finanzielle Sicherheit. Das Berliner Start-up benötigt bis zu 87,5 Millionen Euro, um seinen Betrieb stabil zu halten und die Expansion fortzusetzen. Eine außerordentliche Hauptversammlung kurz vor Weihnachten soll den Weg für ein entsprechendes Wandeldarlehen freimachen. Die Lage zeigt, wie angespannt das Geschäftsmodell trotz operativer Fortschritte bleibt.
Das Kapitalpolster schmilzt schneller als geplant
Über ein Jahr ist vergangen, seit Flink zuletzt frisches Geld aufgenommen hat. Im September 2024 flossen 150 Millionen Euro, doch die Mittel reichen nicht mehr aus. Nach Informationen aus einem internen Dokument soll das neue Kapital bis Ende Juni zur Verfügung stehen – ein eng getakteter Zeitplan für ein Unternehmen, das weiterhin hohe Vorleistungen trägt und in neue Standorte investiert.
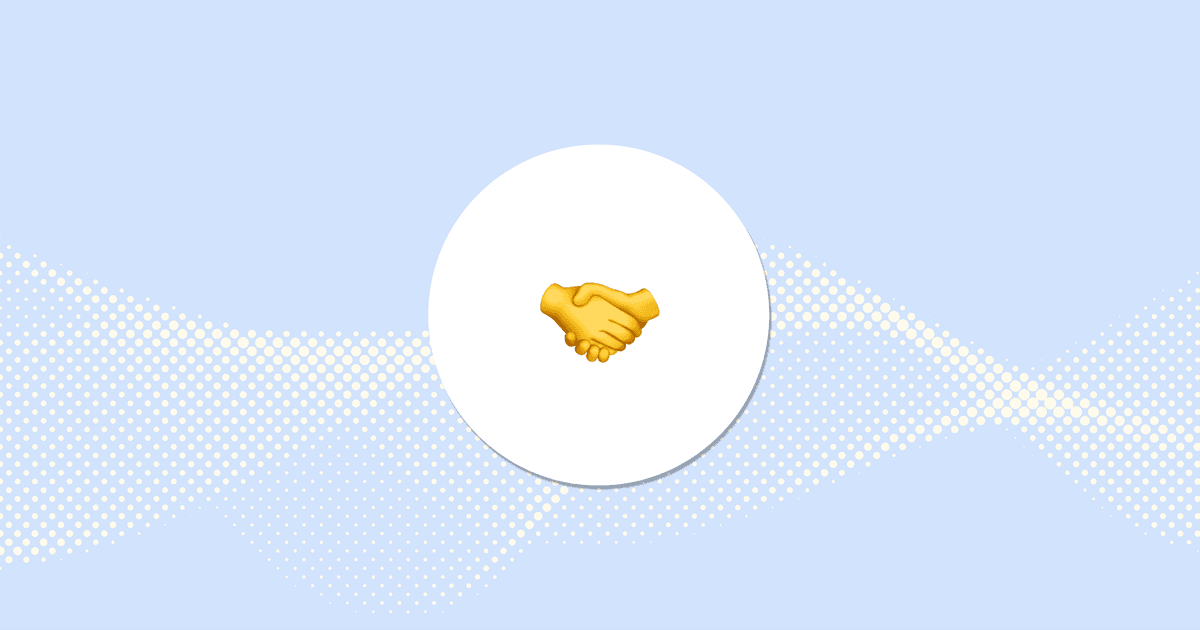
Offiziell betont Flink, es gebe „aktuell keine laufende Finanzierungsrunde in dieser Größenordnung“. Das Dokument sei lediglich eine Vorsorgemaßnahme, notwendig aufgrund der SE-Struktur. In der Branche versteht man solche Hinweise allerdings als deutlichen Vorboten ernsthafter Finanzierungsgespräche. Ein Start-up, das vorsorglich fast 90 Millionen Euro einplant, rechnet mit Engpässen.
Der Markt ist bereinigt – doch die Kosten bleiben hoch
Flink hat die Konsolidierungsphase im Quick-Commerce überstanden. Seit dem Ausstieg der Konkurrenten ist das Unternehmen der einzige großflächige Anbieter in Deutschland. Die Logik dahinter: weniger Wettbewerb, höheres Volumen, bessere Auslastung der Lager – und am Ende die Chance auf nachhaltige Profitabilität.
Tatsächlich meldete Flink erstmals schwarze Zahlen auf Quartalsebene. Doch diese Nachricht verdeckt, wie fragil das Modell bleibt. Neue Standorte verschlingen Kapital, die städtische Logistik bleibt teuer, Personalkosten steigen, und der margenarme Lebensmittelhandel setzt selbst erfolgreichen Lieferdiensten Grenzen. Wachstum ist notwendig, Stabilität aber teuer erkauft.
Investoren halten den Fuß auf der Bremse – und zugleich am Hebel
Zwei potenzielle Neuinvestoren erhöhen den Druck und die Erwartungen: Amazon und der Technologie-Investor Prosus. Beide gelten als strategisch denkbar, beide als anspruchsvoll, wenn es um Beteiligungsbedingungen geht. Die Gespräche sind nicht bestätigt, aber allein die Erwähnung zeigt, wie stark Flinks Zukunft von kapitalstarken Partnern abhängt.
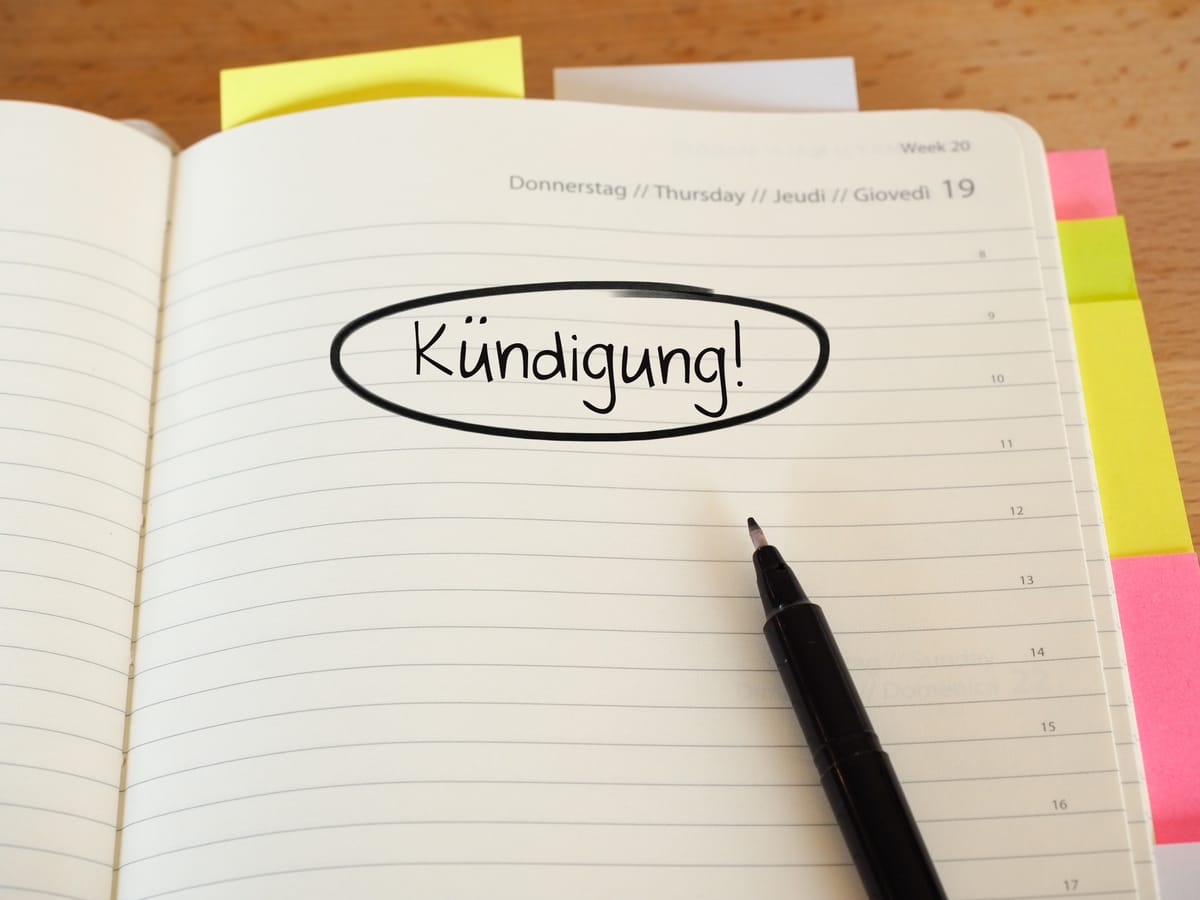
Der Handelskonzern Rewe, mit rund 20 Prozent der wichtigste Einzelinvestor, liefert nicht nur einen Großteil des Sortiments, sondern profitiert auch operativ von Flinks Infrastruktur. DoorDash bleibt ein signifikanter Anteilseigner mit internationaler Skalierungserfahrung. Beide könnten die Finanzierung sichern – oder an harte Bedingungen knüpfen.
Ein Start-up im Übergang – mit neuer Führung und altem Risiko
Die Gründergeneration ist nicht mehr an Bord. Oliver Merkel und Christoph Cordes verließen das Unternehmen Anfang 2025. Seitdem führt Mitgründer Julian Dames das Geschäft alleine. Der Führungswechsel kam zu einer Zeit, in der Flink seine Abläufe verschlanken, die Logistik stabilisieren und die Standorteinteilung neu ordnen musste.
Diese Transformation hat Wirkung gezeigt – aber auch finanzielle Spuren hinterlassen. Wachstum und Effizienzsteigerung laufen parallel, und beides kostet. Dass Flink heute der einzige Anbieter seiner Art ist, macht die Lage nicht einfacher. Der Markt ist zwar bereinigt, aber die Erwartungshaltung höher denn je.
Der entscheidende Sommer
Flink muss bis Juni entscheiden, wie die Zukunft finanziert wird – und in welcher Form. Ein Wandeldarlehen kann den Spielraum sofort vergrößern, verwässert aber frühere Investoren. Ein strategischer Investor könnte Stabilität bringen, verlangt aber Einfluss.
In der Quick-Commerce-Branche ist Stabilität kein Zustand, sondern eine Phase. Flink steht nun vor der wichtigsten: der, in der sich entscheidet, ob das Geschäftsmodell dauerhaft trägt – oder ob selbst Marktführer ohne Kapitalnachschub nicht weit kommen.




