Die deutsche Start-up-Szene galt lange als auf der Jagd nach dem „nächsten großen Ding“: eine App, die zum Unicorn wird, eine Plattform, die Märkte revolutioniert. Doch die KI-Euphorie und der Sinkflug vieler Hype-Firmen haben den Blick geschärft. Statt Luftschlössern entdecken Investoren und Gründer derzeit ein Geschäftsmodell, das erstaunlich bodenständig wirkt – und gerade deshalb Millionen verspricht: Roll-ups.
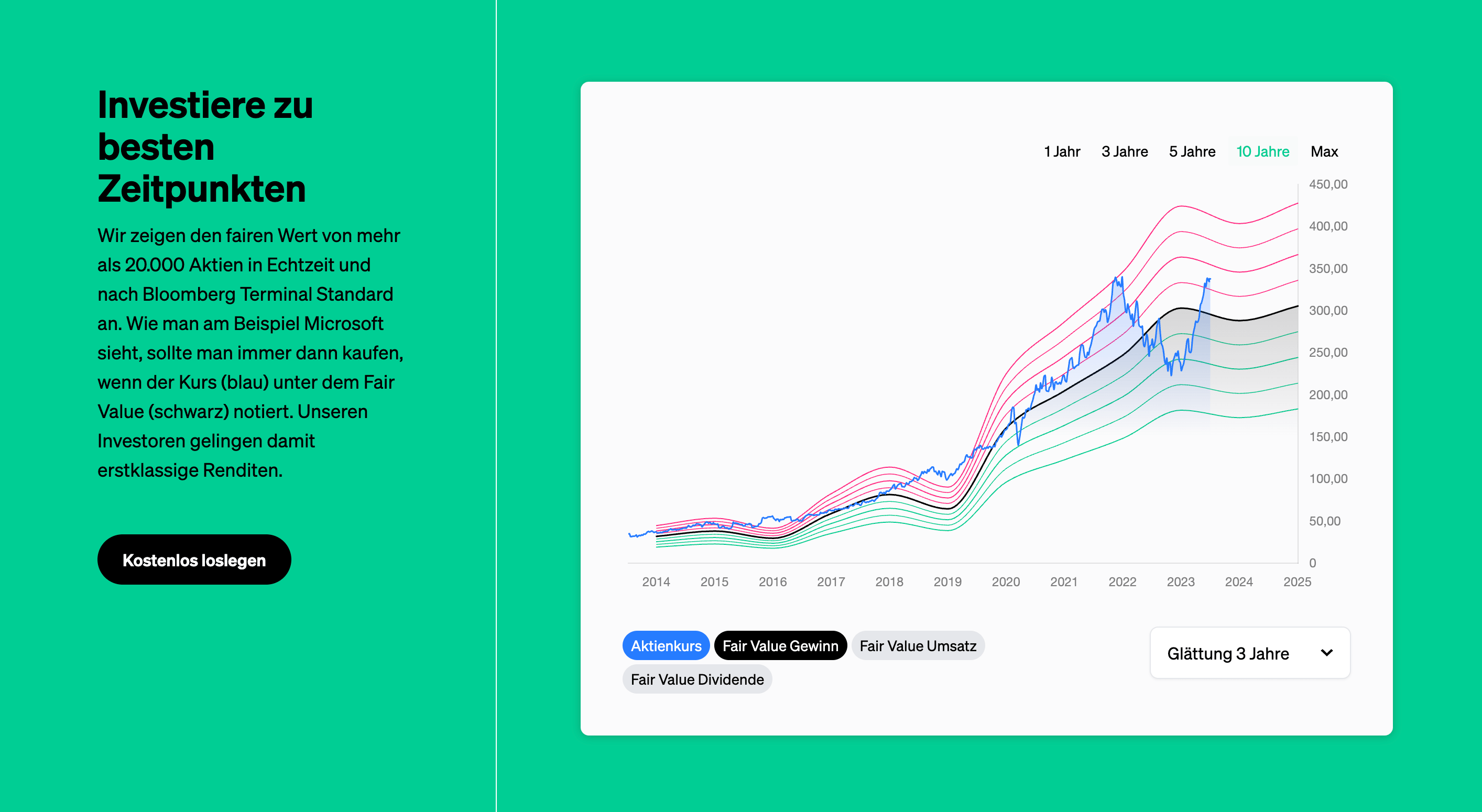
Das Prinzip ist simpel, aber effektiv: Viele kleine Betriebe in einer stark fragmentierten Branche werden zusammengekauft, unter einem Dach gebündelt, digitalisiert und effizienter geführt. Private-Equity-Giganten wie Blackstone oder KKR machen es seit Jahren vor. Nun entdecken auch Venture-Capital-Fonds das Modell für sich.
Arsipa: Wie Betriebsärzte zur Goldgrube wurden
Den Startschuss für den Trend lieferte Arsipa aus Berlin. Das Unternehmen, das Arbeitsmediziner und Sicherheitsspezialisten digital organisiert, wurde vor kurzem an Warburg Pincus verkauft – kolportiert zu einer Bewertung im dreistelligen Millionenbereich. Gründer Felix Jander und Stefan Schmidt hatten zuvor über Jahre kleine Praxen übernommen und ein Mittelstands-Imperium aufgebaut. Ausgerechnet in einer Branche, die bislang alles andere als glamourös schien, gelang ihnen der Durchbruch.
Der Deal wirkte wie ein Dammbruch: Plötzlich wollen Gründerteams nicht mehr nur den nächsten Online-Shop hochziehen, sondern lieber ganze Handwerks- oder Heilberufe konsolidieren. Dachdecker, Optiker, Brandschutz – wo immer viele kleine Anbieter um Aufträge konkurrieren, wittern Investoren nun eine Milliardenchance.
Die Jagd auf fragmentierte Märkte
Die Logik hinter den Roll-ups ist bestechend: Größere Strukturen senken Kosten, zentralisierte Buchhaltung und Recruiting sparen Zeit, digitale Tools heben Produktivität und Margen. Zugleich bieten viele Handwerks- oder Gesundheitsbranchen eine Planbarkeit, die Start-ups im Digitalsektor oft fehlt.

Kein Wunder also, dass auch bekannte Venture-Fonds aufspringen. Tengelmann Ventures, einst Großinvestor bei Zalando, verdient inzwischen kräftig mit. Discovery Ventures und Cherry Ventures prüfen eigene Fonds. Und Gründer wie Lucas von Cranach (Onefootball) oder Serienunternehmer Max Renneberg steigen in Optikerketten und Botox-Kliniken ein.
Von der Vision zum „boring business“
Dass sich ehemalige Tech-Pioniere plötzlich für Dachverbünde oder Zahnarztketten begeistern, sagt viel über die Krise des klassischen Start-up-Modells. Viele Venture-Fonds sitzen auf Verlusten, Exits lassen auf sich warten. Roll-ups versprechen hingegen ein kalkulierbares Geschäft: keine Fantasie-Milliardenbewertungen, aber solide Multiplikatoren – im besten Fall eine Verzehnfachung des Einsatzes.
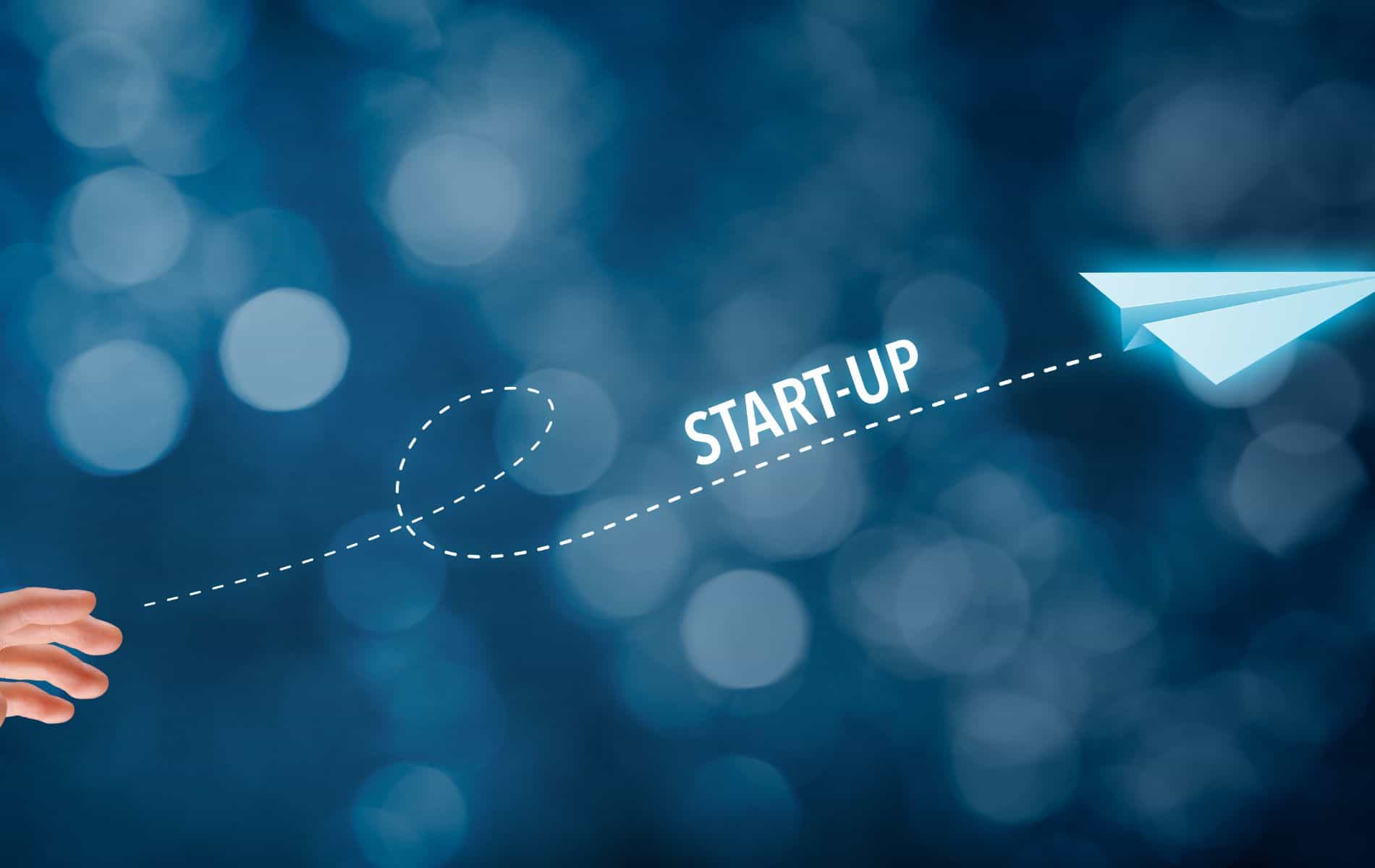
Doch die Risiken sind real. Integration ist schwierig, Kulturen prallen aufeinander. Wo Ex-Investmentbanker plötzlich Handwerksbetriebe führen, sind Konflikte programmiert. Noch schwerer wiegt: Geht nach einer Übernahme die Schlüsselperson – etwa der Meister im Dachbetrieb oder der erfahrene Arzt in der Praxis – verloren, fällt der Wert des Deals dramatisch.
KI als Heilsbringer – oder nur Nebelkerze?
Viele Investoren liebäugeln damit, ihre Roll-ups zusätzlich mit KI aufzuwerten: Software, die Personalplanung oder Diagnosen unterstützt, Marketing automatisiert, oder Kundenströme optimiert. Doch Experten warnen: In vielen dieser Branchen sei es noch viel zu früh, von echter KI-Revolution zu sprechen. Zunächst müsse man Prozesse digitalisieren, die heute noch auf Papier laufen. „Boring business is good business“, sagen erfahrene Roll-up-Manager – die wahre Kunst liegt darin, unspektakuläre Branchen profitabel zu skalieren.
Warum der Mittelstand zum Spielball wird
Besonders spannend ist, dass ausgerechnet der deutsche Mittelstand, lange als Bollwerk gegen radikale Investoren gefeiert, nun ins Visier von Roll-up-Strategien gerät. Wo früher Familienbetriebe in dritter Generation regierten, klopfen heute Start-up-Teams mit Private-Equity-Mentalität an die Tür. Für Verkäufer oft attraktiv: Statt mühseliger Nachfolgesuche winken schnelle Deals, für Investoren stabile Cashflows.
Doch was bleibt, wenn Handwerksbetriebe, Arztpraxen oder Optikerfilialen von Finanzinvestoren getrieben werden? Kritiker fürchten den Verlust von Tradition und regionaler Verankerung. Befürworter sehen die Chance, dass Digitalisierung und Konsolidierung endlich Schwung in alteingesessene Branchen bringen.
Ein Paradigmenwechsel in Echtzeit
Dass deutsche Gründer und Investoren im großen Stil auf Roll-ups setzen, ist mehr als ein kurzfristiger Trend. Es markiert eine tektonische Verschiebung im Selbstverständnis der Start-up-Szene. Nicht mehr nur der nächste Unicorn-Traum zählt, sondern die Fähigkeit, kleinteilige Märkte zu orchestrieren. Weniger Vision, mehr Excel. Weniger Glanz, mehr Handwerk.
Ob aus Dachdeckern, Betriebsärzten oder Botox-Kliniken die neuen Millionenmaschinen werden, wird sich zeigen. Sicher ist: Die deutsche Venture-Szene lernt gerade eine neue Disziplin – und entdeckt, dass Rendite manchmal dort entsteht, wo es am wenigsten nach „Disruption“ aussieht.



