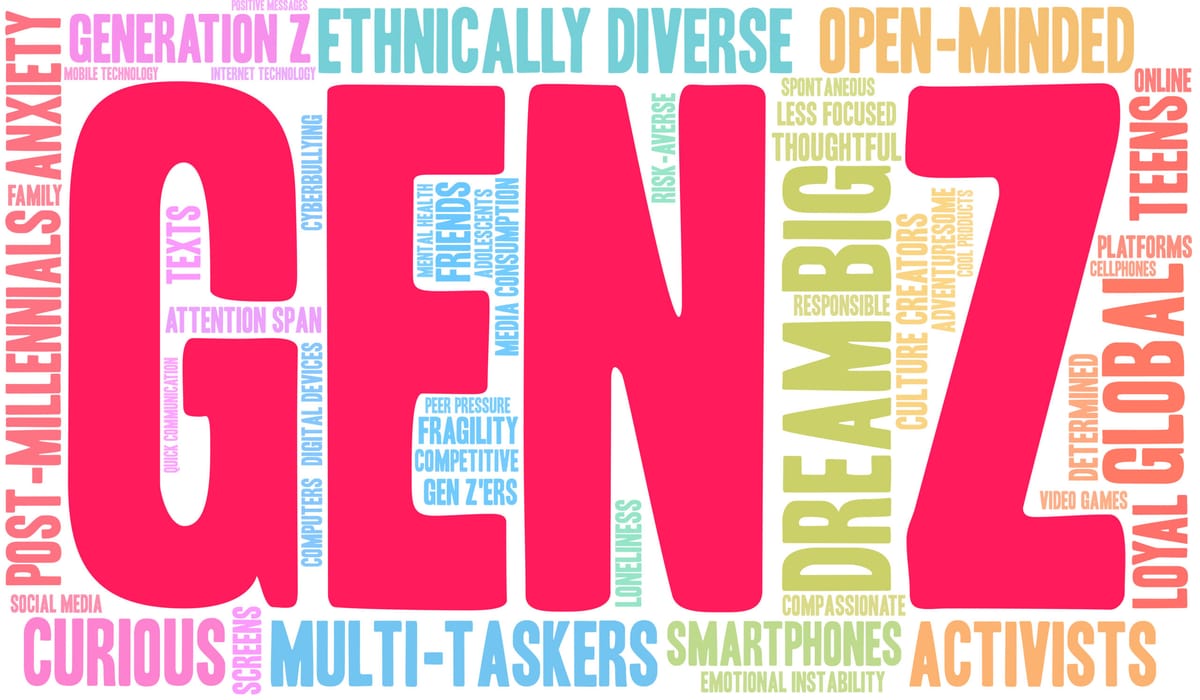Schulden bis zur Rente
Wer heute in Deutschland ein Haus kaufen will, muss fast 30 Jahre tilgen – das sind zwölf Jahre mehr als noch vor zehn Jahren. Und es könnten bald noch mehr werden.
Denn obwohl die Preise zuletzt wieder anziehen, bleibt politischer Rückenwind Mangelware. Der Staat mauert. Und die Immobilienkrise verschärft sich.
Der Traum vom Haus stirbt leise
Er war mal ein Versprechen an die Mittelschicht: der Einzug ins eigene Heim, mit Garten, Sicherheit und Perspektive. Doch dieses Versprechen verblasst – und zwar messbar.
Analyst Philipp Immenkötter hat für das Flossbach von Storch Research Institute die Tilgungsdauer für durchschnittliche Immobilienkäufer über zwei Jahrzehnte zurückverfolgt. Sein Befund: Was einst mit 15 Jahren zu stemmen war, dauert heute fast doppelt so lang.
Noch im Rekordjahr 2015 konnten Haushalte ihre Immobilienfinanzierung in durchschnittlich 15 Jahren schultern. Die Einkommen stiegen, die Zinsen waren rekordniedrig.
Doch mit Krieg, Inflation und EZB-Zinswende kehrte sich der Trend radikal um. 2022 lag die rechnerische Tilgungsdauer plötzlich bei 37 Jahren – fast ein Berufsleben.

Die Restschuld wird zum Damoklesschwert
„Wer heute eine niedrige Tilgung vereinbart, läuft Gefahr, in zehn Jahren auf einer hohen Restschuld zu sitzen – bei deutlich höheren Zinsen“, warnt Immenkötter. Was in Finanzierungsportalen als günstige Monatsrate lockt, kann sich in der zweiten Finanzierungsrunde bitter rächen – nicht nur für die Kreditnehmer, sondern auch für Banken, die dann Nachfinanzierungen absagen müssen.
Die Folge: Immer mehr Haushalte scheitern schon am ersten Schritt. Sie bekommen gar keinen Kredit mehr. Und falls doch, bleibt die Ungewissheit, ob die Finanzierung langfristig tragfähig ist.
Es sind nicht nur Preise oder Zinsen, die drücken – auch energetische Sanierungspflichten und Instandhaltungskosten treiben die Rechnung nach oben. Für viele Familien bleibt nur noch das Zuschauen.
Besserung in Sicht? Wohl kaum
Zwar zeigen Zahlen der Interhyp in Zusammenarbeit mit dem IW Köln einen leichten Rückgang der Belastungsquote – auf 35 Prozent des Nettoeinkommens. Doch das Bild trügt.
Die Verbesserung geht oft auf sinkende Kaufpreise in ländlichen Regionen zurück. In strukturschwachen Gebieten mit wenig Nachfrage. In München etwa liegt der Erschwinglichkeitsindex bei 59 – das bedeutet: Der Hauskauf ist dort nur für Spitzenverdiener realistisch.
Lesen Sie auch:

In 175 der 400 untersuchten Landkreise hat sich die Erschwinglichkeit im Vorjahresvergleich sogar wieder verschlechtert. Gerade in wirtschaftsstarken Regionen oder Städten mit Zuzug ist der Trend eindeutig: Kaufen wird schwerer. Nicht leichter.
Wo bleibt die politische Offensive?
Die Ampelkoalition hatte einst versprochen, das Eigentum stärker zu fördern – vor allem für Familien. Doch bislang bleibt es bei Prüfaufträgen und Prüfungen der Prüfaufträge. Ein Stufentarif bei der Grunderwerbsteuer? Fehlanzeige. Öffentliche Nachrangdarlehen? Kaum bekannt. Staatliche Bürgschaften für Ersterwerber? Noch nicht einmal in der Pilotphase.
Dabei wäre genau das jetzt nötig: gezielte Entlastung bei Nebenkosten, weniger Bürokratie beim Kredit, mehr Baugrund in attraktiven Lagen. Denn solange das Angebot nicht wächst, bleibt auch Eigentum knapp – und teuer. Die Eigentumskrise ist auch eine Neubaukrise.
Deutschland bleibt das Land der Mieter
Mit einer Wohneigentumsquote von 44 Prozent liegt Deutschland im EU-Vergleich auf den hinteren Rängen. In Rumänien leben 95 Prozent der Menschen in den eigenen vier Wänden. In Polen, Spanien oder Italien sind es um die 70 bis 80 Prozent. Selbst Österreich liegt mit 51 Prozent vorn. Und das war nicht immer so: Seit 2011 ist die Quote hierzulande sogar leicht gesunken.
Die Gründe liegen auf der Hand: hohe Kaufpreise, hohe Kaufnebenkosten, hohe Eigenkapitalanforderungen. Dazu ein Wohnungsmarkt, der sich immer weiter verengt, ein Baukostenindex, der durch die Decke geht, und eine Regierung, die beim Eigentum lieber zögert als handelt.
Weniger Eigentum – mehr Ungleichheit
Die IW-Ökonomen Pekka Sagner und Michael Voigtländer warnen: Die geringe Eigentumsquote hat nicht nur ökonomische, sondern auch gesellschaftliche Konsequenzen. Eigentum ist Altersvorsorge, Inflationsschutz und Stabilitätsanker zugleich. Es stärkt die soziale Bindung an Wohnviertel, schafft langfristige Perspektiven und verringert das Risiko der Verdrängung.
Gleichzeitig öffnet sich die Vermögensschere weiter: Wer kein Vermögen bilden kann, bleibt dauerhaft Mieter – und das in einem Markt, dessen Preise in den letzten 15 Jahren explodiert sind. Auch deshalb fordern die Wissenschaftler einen Kurswechsel: hin zu mehr Förderung, mehr Transparenz – und einer politischen Haltung, die Eigentum nicht länger als Privileg, sondern als gesellschaftliches Ziel versteht.
Das könnte Sie auch interessieren: