KI-Agenten verlagern die Kundenschnittstelle
Die Entwicklung vollzieht sich schneller, als es die Branche vor wenigen Monaten für möglich hielt. Mit dem Agentic Web entstehen Systeme, die nicht mehr nur Preise vergleichen, sondern selbst einkaufen, bezahlen und bald auch Finanzentscheidungen treffen. Protokolle wie das Agentic Commerce Protocol von OpenAI und Stripe zeigen, wie tief Agenten bereits in Zahlungsprozesse eingebettet sind. Google und Paypal ziehen nach – der Standard setzt sich rasch durch.
Damit verschiebt sich die Perspektive: Nicht der Mensch interagiert mit Banken, sondern sein autonomer Einkäufer. Diese technologische Weichenstellung trifft den Kern des Bankgeschäfts: die Kontrolle über den primären Zugang zum Kunden.
Finanzagenten übernehmen Aufgaben, die heute noch Menschen erledigen
Aus Einkaufsagenten werden Finanzagenten. Sie wechseln Konten, optimieren das Sparkonto, entscheiden über Kreditkarten, investieren nach programmierten Vorgaben – und kommunizieren dabei direkt mit den technischen Schnittstellen der Banken. Die Konsequenz: APIs werden zum eigentlichen Kundenzugang.
Damit gewinnt ein Gedanke an Relevanz, der in der Fintech-Debatte der 2010er-Jahre bereits aufkam: Wenn die Kundenschnittstelle verschwindet, bleibt Banken die Rolle des Infrastrukturbetreibers. Der Unterschied zur damaligen Situation liegt darin, dass Agenten die Ebene zwischen Banken und Fintechs gleich mit ersetzen können.

Die alte Fintech-Frage kehrt zurück – diesmal mit größerer Wucht
Viele Banken hatten nach dem Fintech-Boom darauf gesetzt, ihre Position zu halten. Sie wurden nicht zu Plattformen, doch Fintechs wurden zu Banken. Gleichzeitig haben Apple, Google und andere Tech-Konzerne das Zahlungsfrontend erobert.
Agentic Finance verstärkt diesen Trend. Der digitale Assistent wird zum Gatekeeper, der entscheidet, welche Bankprodukte überhaupt relevant bleiben. Für Fintechs ist die Bedrohung sogar größer: Viele ihrer Services – von Budgetsteuerung bis Kartenoptimierung – übernehmen Agenten künftig selbst.
Technische Agentenfähigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor
Banken müssen sich deshalb nicht nur technisch anpassen, sondern strategisch. Wenn der Agent in Echtzeit Finanzprodukte bewertet, werden Entscheidungskriterien wie Zinsen, Gebühren, Verfügbarkeiten oder API-Qualität radikal transparenter. Die „Bequemlichkeitsrendite“ – also die Trägheit des Kunden – verschwindet.
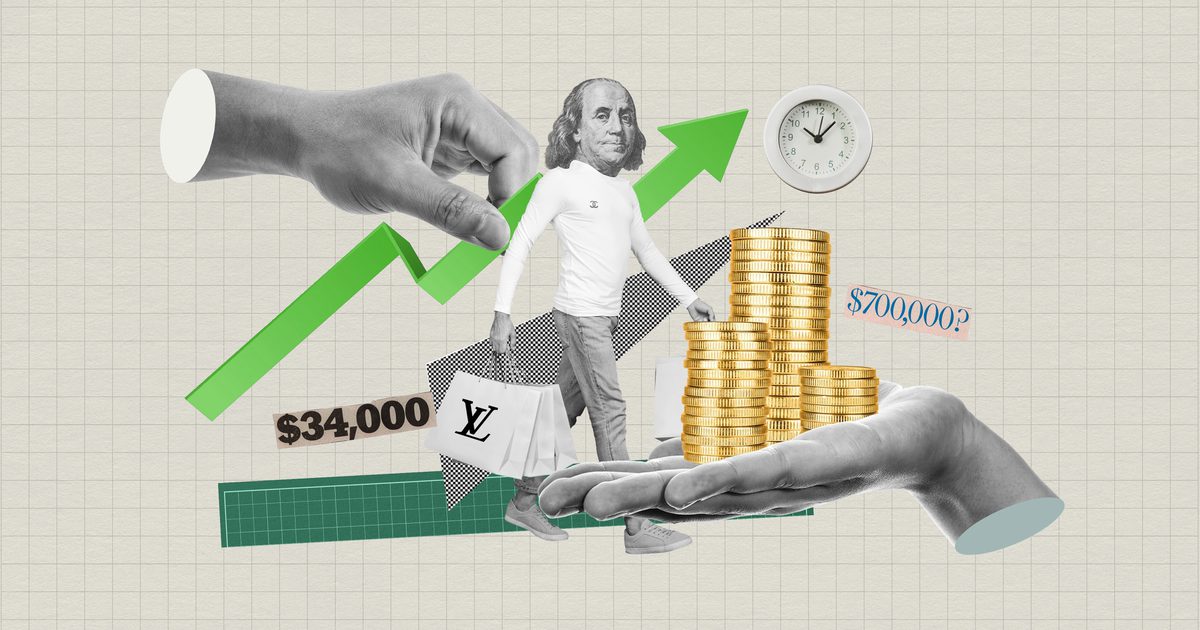
McKinsey erwartet, dass Agenten Einlagen aggressiv zu den besten Zinsen verschieben und Kreditkartenzahlungen automatisch über das jeweils vorteilhafteste Produkt leiten. Loyalität spielt kaum noch eine Rolle. Was zählt, sind die objektiven Produktparameter.
Banken brauchen ein neues Wertversprechen – für Maschinen, nicht für Menschen
Banken müssen klären, womit sie künftig Agenten überzeugen wollen. Eine Marke, Filialnähe oder ein gutes Beratungsgespräch sind für autonome Systeme unerheblich. Was zählt, ist messbare Attraktivität: Geschwindigkeit, verlässliche APIs, stabile Prozesse, klare Konditionen.
Gleichzeitig steht die Frage im Raum, ob Banken eigene Agenten entwickeln sollten, um ihre Kunden im eigenen Ökosystem zu halten. Das ist technisch möglich, aber strategisch riskant. Der Vorsprung der großen KI-Anbieter ist enorm, und die Nutzerakzeptanz privater KI-Ökosysteme wächst.
Die nächste Disruptionswelle ist näher als gedacht
Agentic Finance zwingt Banken dazu, alte Gewissheiten zu hinterfragen und neue Fähigkeiten aufzubauen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung übertrifft alles, was der Sektor seit dem Aufkommen der Fintechs erlebt hat. Wer sich nicht vorbereitet, wird von Agenten schlicht nicht mehr ausgewählt – und für einen wesentlichen Teil des Marktes unsichtbar.




