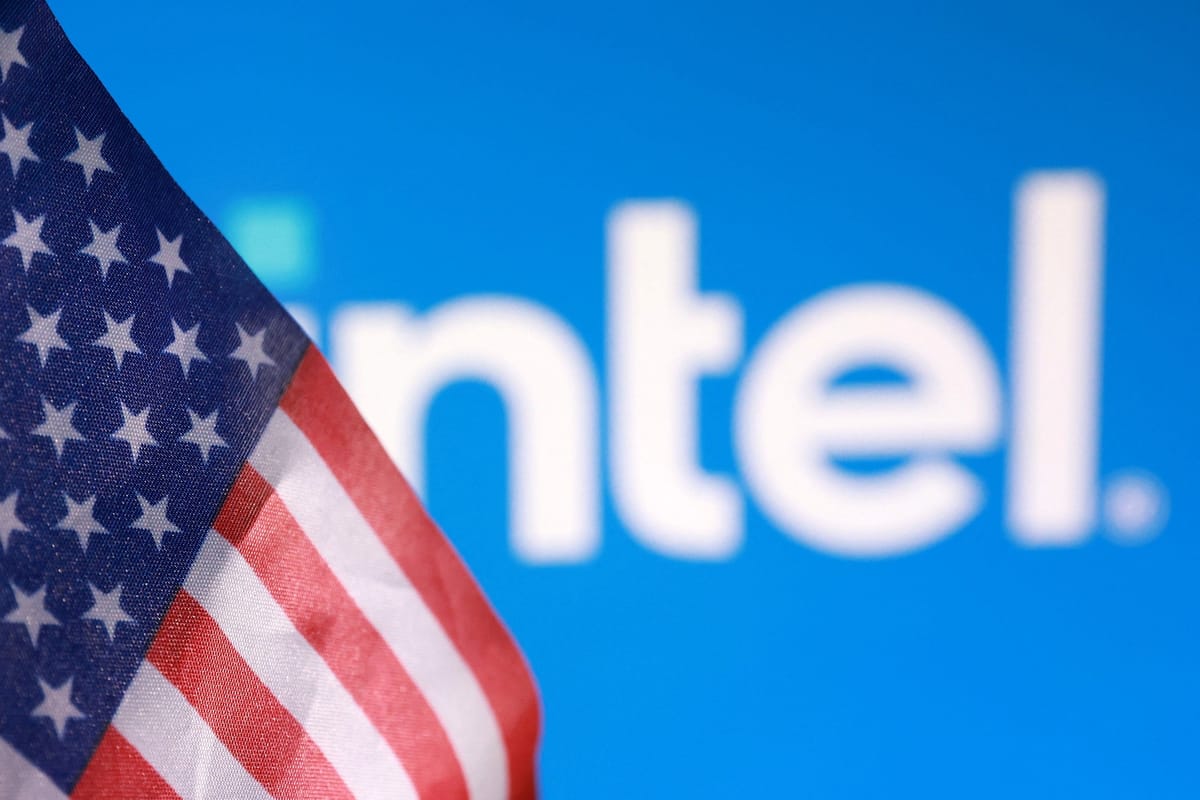Donald Trump hat wieder zugeschlagen. Mit einem Federstrich besitzt die US-Regierung nun 10 % des Chipriesen Intel – ein Schritt, der weit über die Grenzen eines simplen Investments hinausgeht.
Trump verkauft den Deal als geschicktes Geschäft, Kritiker sehen in der Transaktion jedoch den Beginn einer neuen Phase der amerikanischen Industriepolitik: Teilverstaatlichung im Namen der Sicherheit.
Chips sind der neue Stahl
Halbleiter gelten als strategische Schlüsseltechnologie – ohne sie läuft weder Künstliche Intelligenz noch moderne Verteidigung. Bisher dominieren Fertiger wie TSMC aus Taiwan die Spitzenproduktion.
Ein geopolitisches Risiko, das Washington seit Jahren umtreibt: zu nah an China, zu verwundbar bei einem Konflikt. Analyst Ben Thompson bringt es auf den Punkt: „Reckless wäre es, nichts zu tun.“ Der Intel-Einstieg soll eine Antwort auf diese Abhängigkeit sein.
Trump-Logik: Macht durch Besitz
Trump selbst begründet den Deal weniger mit Strategie, sondern mit einem Vergleich aus der Immobilienwelt: Wer den Schlüssel in der Hand hält, kassiert ab. In seinen Worten: „If I can stop you from doing something, you usually have to pay.“ Intel-CEO Lip-Bu Tan dürfte die Botschaft verstanden haben. Washington will nicht nur mitreden, sondern mitverdienen – und das nicht nur bei Intel.

Wer ist der Nächste?
Im Raum stehen bereits Namen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman oder gar Cloud-Giganten aus dem Tech-Sektor. Verteidigungsministerien und Handelsressort prüfen ähnliche Beteiligungen – offiziell im Interesse der „national security“.
De facto würde es die Grenze zwischen Privatwirtschaft und Staat weiter verwischen. Die Frage, die bleibt: Dient das der Stabilität – oder eher Trumps Machtdemonstration?
Risiko für Anleger und Märkte
Für Investoren birgt das Modell Sprengstoff. Einerseits sichert ein staatlicher Ankeraktionär Subventionen und politischen Rückhalt. Andererseits erhöht er das politische Risiko: Was, wenn die Regierung nicht als Partner, sondern als dominierender Anteilseigner agiert?
Exportsteuern auf Nvidia- und AMD-Chips zeigen bereits, wie schnell Trump wirtschaftliche Macht als politisches Werkzeug einsetzt.
Das Ende der alten Ordnung
Trump 2.0 stellt erneut Konventionen auf den Kopf. Handelszölle, Exportsteuern und nun Staatsbeteiligungen – alles im Schnelltempo. Was als Ausnahme verkauft wird, könnte schnell zum Standard werden. Investoren und Manager müssen sich darauf einstellen, dass strategische Industrien künftig weniger frei und stärker politisch gelenkt agieren.
Eines ist klar: Mit Intel hat Trump ein Signal gesendet – und es wäre naiv zu glauben, es bliebe bei diesem einen Signal.
Das könnte Sie auch interessieren: