Ein idyllischer Ort mit Sprengkraft
Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming: Seit Jahrzehnten versammeln sich hier im Spätsommer die mächtigsten Notenbanker der Welt. Normalerweise geht es um Fachdebatten über Zinskurven und Konjunkturtrends.
Dieses Jahr aber liegt eine besondere Schwere über dem Treffen. Denn erstmals seit den 1980er-Jahren steht das Grundprinzip der Geldpolitik selbst infrage – die Unabhängigkeit der Zentralbanken.
Trumps Feldzug gegen die Fed
Kein Präsident hat den Druck auf die Federal Reserve so massiv erhöht wie Donald Trump. Fast wöchentlich attackiert er Fed-Chef Jerome Powell, verspottet ihn als „Mister Immer zu spät“ und droht offen mit seiner Entlassung.
Parallel installiert er Verbündete in Schlüsselpositionen, zuletzt seinen früheren Wirtschaftsberater Stephen Miran. Selbst persönliche Vorwürfe gegen einzelne Fed-Mitglieder, wie gegen Lisa Cook, tragen die Handschrift einer politischen Kampagne.
Das Ziel ist klar: Trump will eine Notenbank, die ihm folgt. Niedrigere Zinsen, billigeres Geld, ein kurzfristiger Konjunkturimpuls – und sei es um den Preis einer instabilen Währung.
Lesen Sie auch:
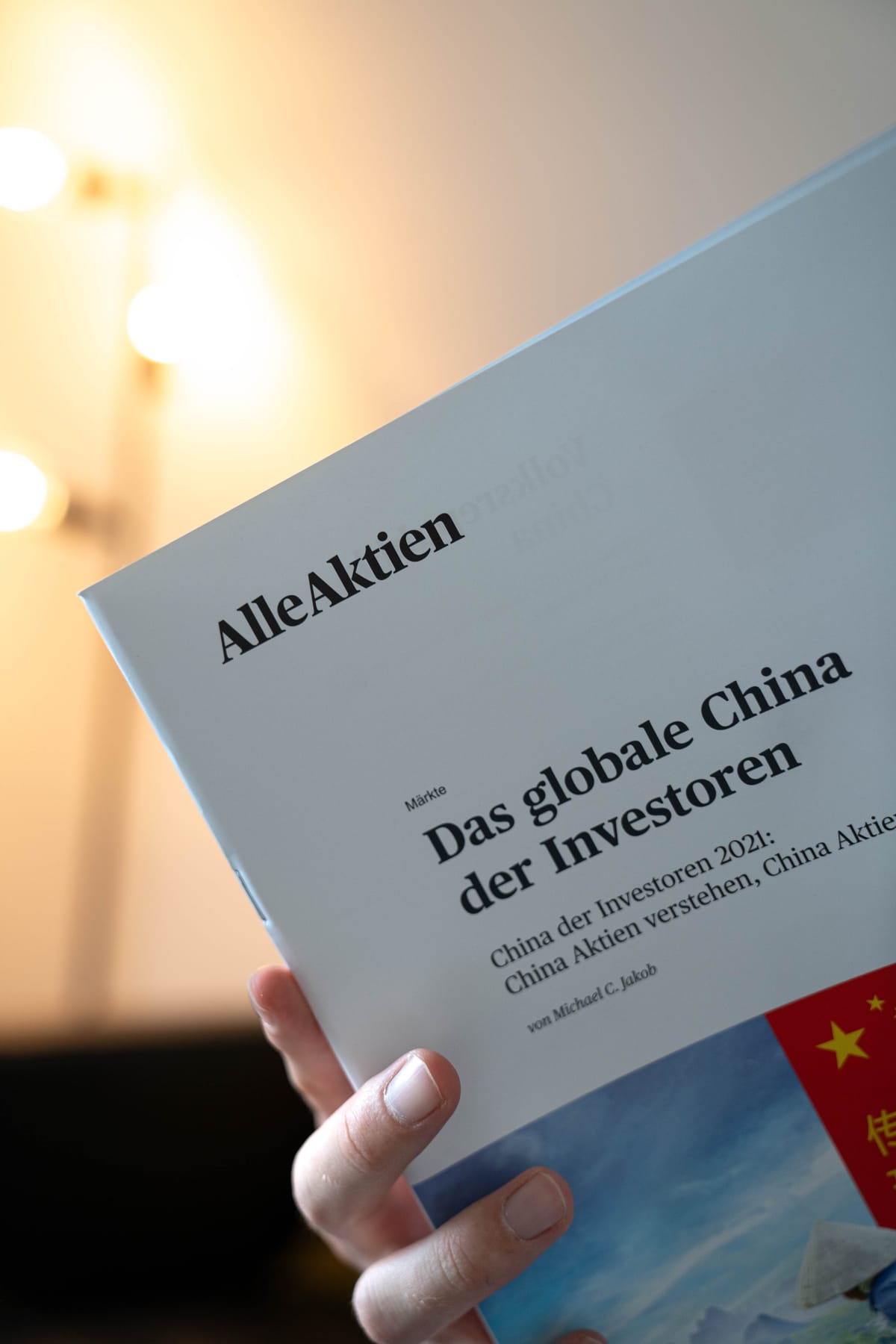
Powell im Gegenwind
Jerome Powell hält sich öffentlich zurück. Sein Mandat läuft noch bis 2026, und er hat mehrfach betont, es auch erfüllen zu wollen. Doch die Fronten sind verhärtet.
Mit einem Leitzins von 4,5 Prozent liegt die Fed weit über Europa oder Japan. Zinssenkungen könnten die Märkte beruhigen, aber auch Inflationsängste neu entfachen. Powell muss in seiner Rede in Jackson Hole einen Balanceakt vollziehen – wohl wissend, dass jede Silbe von Trump ausgeschlachtet wird.
Der Arbeitsmarkt als Prüfstein
Besondere Brisanz erhält die Debatte durch den Arbeitsmarkt. Die jüngsten Zahlen zeigen Schwäche, Korrekturen nach unten verunsichern zusätzlich. Für die Fed, die neben Preisstabilität auch Vollbeschäftigung im Mandat hat, ist das ein Dilemma.

Trump deutet die Entwicklung als Erfolg seiner Migrationspolitik. Powell dagegen warnt vor vorschnellen Schlüssen – und verweist auf die Rolle von Technologie und Produktivität.
Gefahr einer Vertrauenskrise
Das eigentlich Beunruhigende ist weniger die nächste Zinsentscheidung als die Frage, ob die Fed überhaupt noch unabhängig agieren kann. Historische Beispiele sind warnend genug: In Argentinien oder der Türkei führte politische Einflussnahme auf die Notenbanken in die Inflation, am Ende brach das Vertrauen in die Währung zusammen.
Ein solches Szenario im Westen wäre ein Schock für die globalen Finanzmärkte – und würde Sparer wie Anleger hart treffen.
Europa stellt sich hinter Powell
Während Trump den Druck erhöht, positionieren sich Europas Währungshüter klar. Auf einer EZB-Konferenz in Sintra erhielt Powell Standing Ovations.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbankchef Joachim Nagel betonten unisono, die Unabhängigkeit sei „Teil der DNA“ von Zentralbanken. Doch das hilft Powell nur bedingt. Entscheidend ist, ob die US-Regierung das Prinzip respektiert – oder nicht.
Sparer müssen reagieren
Für Anleger bedeutet die Unsicherheit: klassische Sparformen bieten keinen Schutz mehr. Wer sein Geld auf Giro- oder Tagesgeldkonten liegen lässt, geht das Risiko schleichender Entwertung ein.
Reale Werte wie Aktien oder Gold gewinnen in diesem Umfeld an Bedeutung. Altersvorsorge und Sparpläne müssen neu kalkuliert werden, denn die Geldordnung, wie wir sie kennen, ist nicht in Stein gemeißelt.
Handeln statt hoffen
Jackson Hole mag landschaftlich idyllisch sein, doch die Fragen, die dort verhandelt werden, sind von historischem Gewicht. Es geht nicht nur um Zinsen und Arbeitsmarkt – es geht um die Machtbalance zwischen Politik und Zentralbanken.
Und um das Vertrauen, auf dem unser Geldsystem ruht. Für Anleger gilt: In Zeiten, in denen politische Eingriffe die Spielregeln verschieben, ist Abwarten die riskanteste Strategie.
Das könnte Sie auch interessieren:


