Ein Schwenk, der Washington aufhorchen lässt
Donald Trump braucht manchmal nur einen einzigen Satz, um die politische Temperatur in Washington um ein paar Grad steigen zu lassen. „Wir haben nichts zu verbergen“, schrieb er auf Truth Social – und forderte seine Republikaner dazu auf, für die vollständige Offenlegung der Epstein-Akten zu stimmen. Für einen Präsidenten, der das Vorhaben monatelang blockiert hatte, ist das ein bemerkenswerter Kurswechsel.
Im Repräsentantenhaus steht in dieser Woche eine parteiübergreifende Abstimmung an, die die Regierung verpflichten würde, sämtliche Unterlagen über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offenzulegen. Lange schien klar: Trump will das verhindern. Nun wirkt es, als hätte er sich eingesehen – oder als hätte er verstanden, dass die Welle ohnehin über ihn hinwegrollen wird.
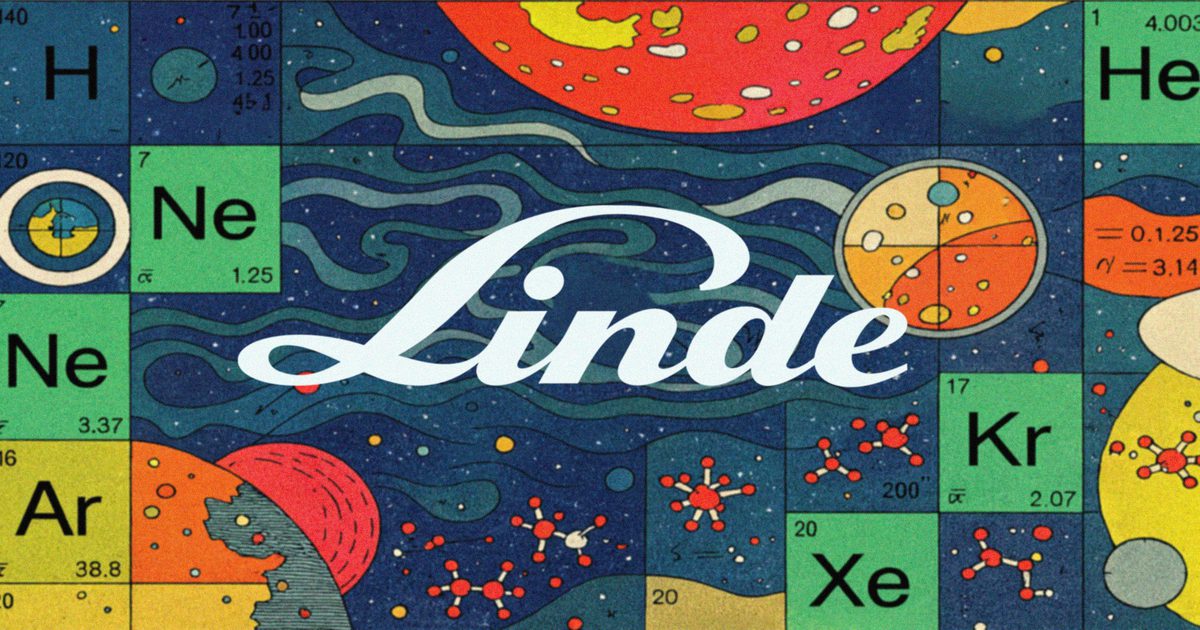
Warum die Kehrtwende gerade jetzt kommt
Hinter dem Schritt steckt keine plötzliche Liebe zur Transparenz, sondern politischer Realismus. Selbst treue Trump-Anhänger aus der MAGA-Bewegung drängen seit Monaten auf komplette Offenlegung. Der interne Druck wurde zuletzt so stark, dass es zum offenen Streit mit Marjorie Taylor Greene kam – einer der loyalsten Stimmen im republikanischen Lager.
Parallel tauchten neue Dokumente auf, darunter eine E-Mail Epsteins aus dem Jahr 2019, in der behauptet wird, Trump habe „von den Mädchen gewusst“. Das Weiße Haus nennt das selektiv und manipulativ, doch der Schaden war da. Die Debatte bekam neues Feuer – und mit ihr eine Dynamik, die sich nicht mehr wegschieben ließ.
Was das Repräsentantenhaus beschließen will
Der Entwurf, über den die Abgeordneten abstimmen, ist weitreichend. Er verpflichtet das Justizministerium dazu, sämtliche Akten, internen Vermerke, E-Mail-Korrespondenzen und Ermittlungsergebnisse zu veröffentlichen – einschließlich aller Unterlagen zu Epsteins Tod im Gefängnis von New York. Ausgenommen wären lediglich Details, die Opfer gefährden oder laufende Verfahren beeinträchtigen.

Für die Republikaner, die das Gesetz vorantreiben, wäre die Freigabe ein politischer Triumph. „Eine große Zahl unserer Leute wird zustimmen“, heißt es aus Fraktionskreisen. Die Mehrheiten stehen – und das ist vermutlich der eigentliche Grund, warum Trump nun vorangeht: Wer sich an die Spitze stellt, kann zumindest so tun, als habe er die Richtung bestimmt.
Der Senat bleibt das Nadelöhr
Selbst wenn das Repräsentantenhaus zustimmt, ist der Weg noch nicht frei. Auch der Senat müsste grünes Licht geben. Erst dann läge die Vorlage wieder auf dem Tisch des Präsidenten – der sie unterschreiben müsste.
Ob es so weit kommt, ist offen. Doch politisch entscheidend ist etwas anderes: Der Epstein-Komplex, den Trump möglichst tief im Archiv versenkt sehen wollte, ist wieder zurück im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Ein Fall, der nie wirklich verschwunden ist
Epstein war 2019 tot in seiner Zelle gefunden worden – laut offizieller Darstellung Suizid, laut zahlreichen Kritikern unter fragwürdigen Umständen. Die Ermittlungen dokumentierten ein Netzwerk aus Missbrauch, Einfluss und Geld. Trump selbst bestreitet jede engere Verbindung. Fotos, Videos und frühere Begegnungen belegen, dass sich beide kannten – aber wie eng diese Bekanntschaft war, ist seit Jahren Streitpunkt.
Der Präsident hatte im Wahlkampf Transparenz versprochen. Nach seiner Vereidigung folgte eine Veröffentlichung, die den Namen kaum verdiente: dünne Dokumente, kaum Inhalt. Der Rest verschwand – bis jetzt.
Ein Präsident, der die Kontrolle über die Erzählung verliert
Trumps neues „Nichts zu verbergen“-Narrativ ist politisch riskant. Wer die Offenlegung fordert, muss damit leben, dass das Ergebnis nicht kontrollierbar ist. Die Epstein-Akten sind keine Sammlung harmlosem Behördenpapiers, sondern ein Dossier über Machtmissbrauch, Verbindungen und Versäumnisse – und über eine Reihe von einflussreichen Menschen, die nicht wollen, dass ihr Name erneut auftaucht.
Doch genau das passiert nun. Und Trump, der jahrelang versucht hat, die Geschichte kleinzuhalten, steht plötzlich im Zentrum.
Der eigentliche Wendepunkt
Nicht die Freigabe der Akten ist die überraschende Nachricht. Überraschend ist, dass Trump sie plötzlich nicht mehr verhindern kann. Seine Zustimmung wirkt weniger wie ein Signal der Stärke als wie eine Kapitulation vor den Mehrheitsverhältnissen – und vor einem politischen Druck, der zu groß geworden ist, um ihn zu ignorieren.




