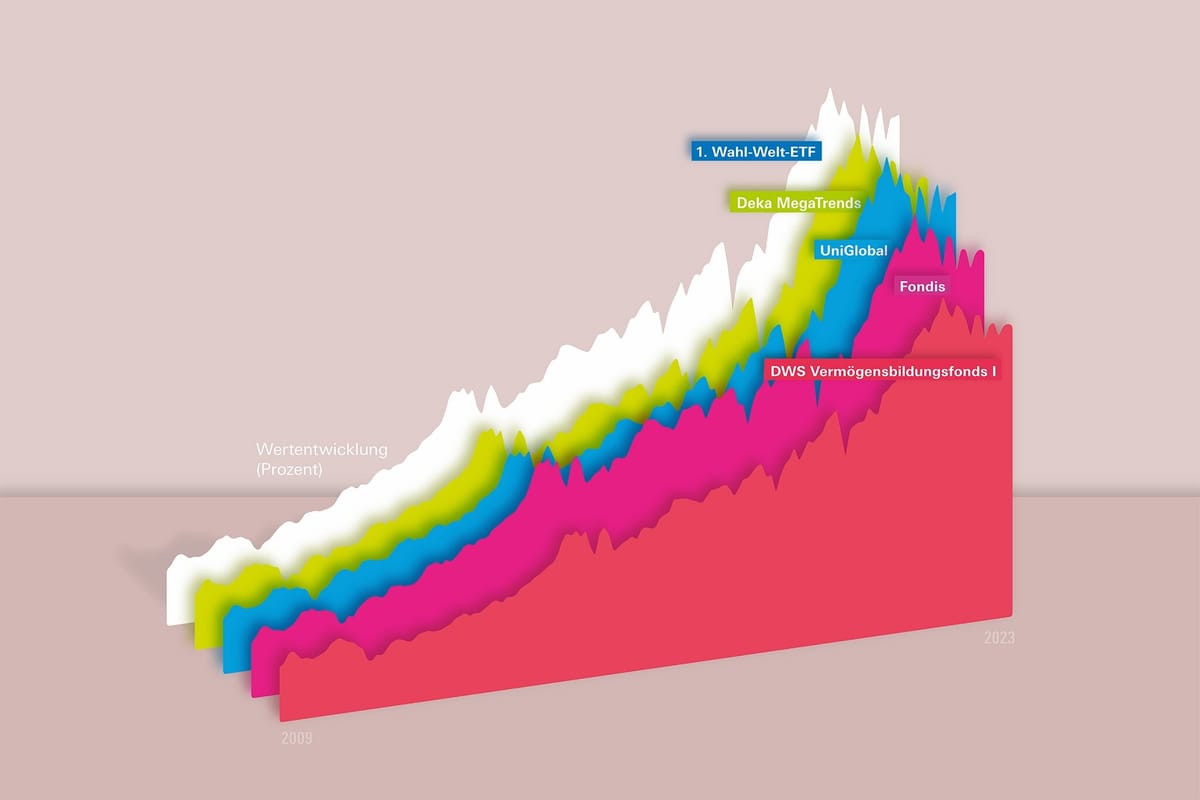Diplomatie auf Trumps Art
Donald Trump macht keine halben Sachen. Nach außen spricht er von Frieden, im Hintergrund lässt er Raketen zählen. Der US-Präsident will nach eigenen Angaben „den unrühmlichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine“ beenden – mit Druck, Drohung und einer großen Portion Eigeninszenierung.
In einem Telefonat mit Wladimir Putin soll er ein persönliches Treffen vereinbart haben. Der Ort: Budapest. Der Gastgeber: Viktor Orbán, der europäische Regierungschef, der Moskau so nahe steht wie kein anderer in der EU. Dass ausgerechnet er nun Vermittler spielen will, passt zu Trumps Verständnis internationaler Diplomatie: Nähe entsteht durch Macht, nicht durch Vertrauen.
Drohen, um Frieden zu schaffen
Kaum war das Treffen in Aussicht gestellt, folgte die Eskalation. Trump kündigte an, der Ukraine mehrere Tausend Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern – Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern, fähig, tief ins russische Territorium einzudringen.
Putin reagierte prompt. Über die russische Nachrichtenagentur Tass ließ er verlauten, die Waffenlieferungen würden „die Lage nicht ändern“, aber „die Beziehungen irreparabel beschädigen“. Zwischen den Zeilen: eine Warnung, dass auf Trumps Drohung eine militärische Antwort folgen könnte.
Der Kremlchef betonte zugleich, seine Truppen seien „entlang der gesamten Front in der Offensive“. Eine Botschaft an Washington – und ein Versuch, Stärke zu demonstrieren, während die russische Armee nach wie vor keine entscheidenden Geländegewinne erzielt.
Budapest als Bühne
Das geplante Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin soll laut US-Angaben in den kommenden zwei Wochen stattfinden, nachdem sich zuvor Verhandlungsteams beider Seiten treffen. Angeführt wird die US-Delegation von Außenminister Marco Rubio.
In Washington empfängt Trump zuvor den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – offiziell, um die Position Kiews in die Gespräche einzubringen. Inoffiziell dürfte es darum gehen, den ukrainischen Präsidenten auf Trumps Kurs einzuschwören: weniger Waffenhilfe, mehr politische Kompromisse.
Budapest ist kein Zufall. Orbán hat sich über Jahre als Brückenbauer zwischen Ost und West inszeniert, blockierte mehrfach EU-Sanktionen gegen Russland und pflegt enge Beziehungen zum Kreml. Ein Treffen unter seiner Schirmherrschaft wäre für Putin ein diplomatischer Triumph – und für Trump eine Gelegenheit, sich als Friedensstifter zu präsentieren.
Der Präsident zwischen Ego und Realität
Trumps Ziel ist klar: Er will den Krieg beenden, oder zumindest den Eindruck erwecken, dass er es kann. Schon im Wahlkampf versprach er, den Konflikt „am ersten Tag seiner Amtszeit“ zu lösen. Seitdem folgte eine Serie enttäuschter Hoffnungen – geplatzte Waffenstillstände, gescheiterte Abkommen, fortgesetzte Kämpfe.
Im August hatte Trump Putin in Alaska empfangen und den Gipfel zunächst als „großen Erfolg“ bezeichnet. Nur Wochen später griff Russland erneut zivile Ziele in der Ukraine an. Der Rückschlag ließ Trump zunehmend ungeduldig werden – und seine Rhetorik aggressiver.
Jetzt spricht er offen von einer „Geduldsgrenze“ gegenüber Moskau. Die angekündigten Marschflugkörper sind weniger militärisches als politisches Signal: Trump will zeigen, dass er bereit ist, Druck auszuüben – notfalls auch auf Kosten einer weiteren Eskalation.

Die Risiken seiner Strategie
Militärisch wäre die Lieferung von Tomahawks an die Ukraine ein Tabubruch. Mit ihrer Reichweite könnten sie russische Raffinerien, Flugplätze oder Kommandozentralen treffen – und Moskau selbst. Ein solcher Schritt würde den Krieg dramatisch verschärfen.
Politisch wäre es ein Spiel auf Zeit. Russland könnte jede Lieferung als Vorwand nutzen, um neue Offensiven zu rechtfertigen. Und Europa? Würde mit Sorge zusehen, wie der fragile Gleichklang zwischen Abschreckung und Diplomatie erneut kippt.
Trumps Team verweist dagegen auf Erfolge im Nahen Osten – den von ihm vermittelten Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. Der Präsident will diesen Erfolg nun in Europa wiederholen. Doch zwischen Gaza und Donezk liegen Welten.
Eine Welt, die Trumps Muster kennt
Trump bleibt sich treu: Drohen, dominieren, dann verhandeln. Für ihn ist Diplomatie ein Handel, kein Balanceakt. Seine Anhänger feiern ihn dafür als Pragmatiker. Seine Kritiker sehen darin eine gefährliche Unberechenbarkeit, die kurzfristige Schlagzeilen über langfristige Stabilität stellt.
Putin kennt das Spiel. Er weiß, dass Trump Aufmerksamkeit liebt – und dass er sie braucht. Das macht die Lage gefährlich: Beide Männer, beide Egos, beide auf der Suche nach dem nächsten Triumph.
Ein Treffen voller Sprengkraft
Ob Budapest Frieden bringt oder nur den nächsten Showdown, ist offen. Klar ist: Trump steht unter Druck, endlich Ergebnisse zu liefern. Und Putin steht unter Druck, Stärke zu zeigen.
Zwischen diesen beiden Erwartungen liegt die gefährlichste aller Zonen – die, in der Diplomatie zur Bühne wird und Drohungen zur Währung.
Wenn Trump und Putin sich treffen, entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Ukraine – sondern auch, ob Machtpolitik im 21. Jahrhundert noch Frieden hervorbringen kann.