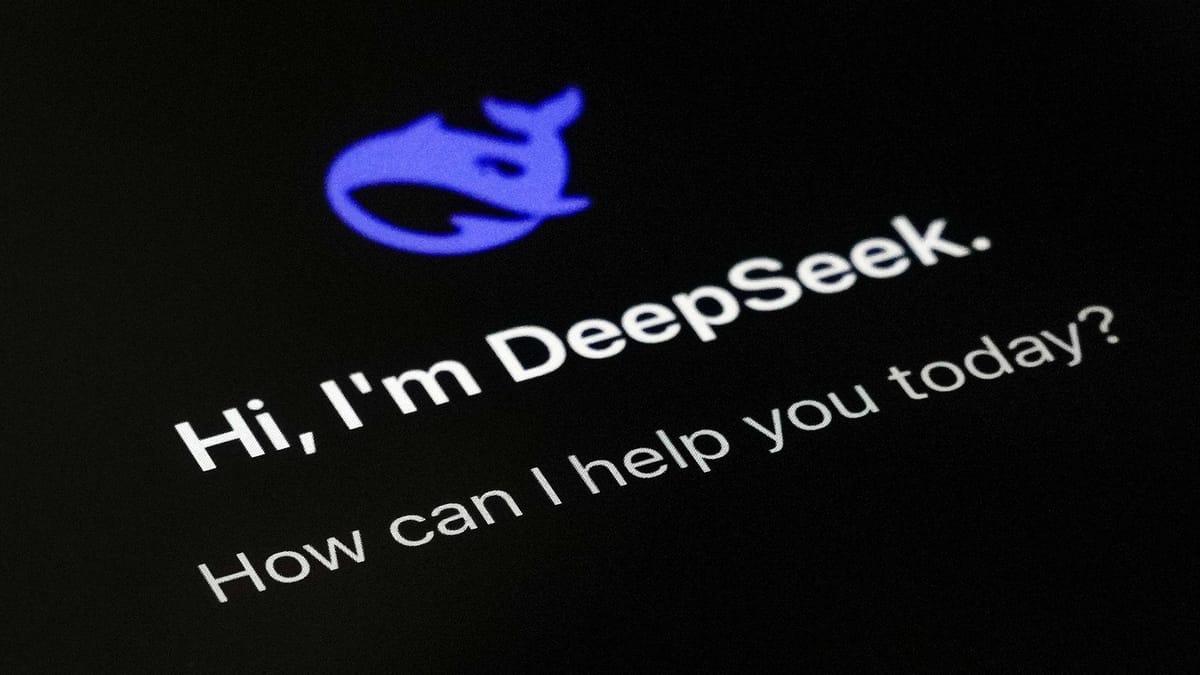Peking hört mit – und Prag will nicht länger mitspielen
Tschechiens Regierung hat genug. Nach monatelanger Prüfung verbannt sie alle Produkte des chinesischen KI-Start-ups Deepseek aus dem Behördenapparat.
Die Sorge ist nicht neu, aber jetzt offiziell: Wenn Beamte mit dem Chatbot arbeiten, landen Anfragen und Dokumente auf Servern, die von einem Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China kontrolliert werden – ein Szenario, das aus Sicht der tschechischen Cyberabwehr keine hypothetische Gefahr mehr ist, sondern ein reales Sicherheitsrisiko.
Cybersicherheitsbehörde schlägt Alarm
Die Entscheidung basiert auf einer Analyse der nationalen Behörde für Cyber- und Informationssicherheit (NUKIB). Diese warnte vor „systemischen Risiken“, insbesondere beim Einsatz von Deepseek auf Geräten mit sensiblen Daten.
Anders als OpenAI oder europäische Anbieter unterliegt das Unternehmen keiner unabhängigen Aufsicht – sondern potenziell den Zugriffsbefugnissen des chinesischen Staates. Vor allem die Möglichkeit, Metadaten, Gesprächsinhalte und Login-Daten systematisch abzugreifen, wird als hochgefährlich eingeschätzt.
Nicht nur Prag reagiert – auch andere Länder ziehen Konsequenzen
Tschechien steht mit seinem Verbot nicht allein. In den USA haben das Verteidigungsministerium, die NASA und diverse Bundesstaaten die Nutzung der Deepseek-App bereits untersagt. Australien, Taiwan und sogar das konservative Texas haben das Tool auf behördlichen Geräten blockiert.

In Deutschland hingegen halten sich die Behörden bislang zurück. Zwar mehren sich Bedenken, insbesondere beim Einsatz von KI-Systemen in Justiz, Polizei oder Gesundheitsämtern – doch ein offizielles Verbot gibt es nicht. Noch nicht.
Was ist Deepseek eigentlich – und wer steckt dahinter?
Deepseek ist einer der größten aufkommenden Chatbot-Anbieter Chinas. Das Unternehmen wurde 2024 mit großzügiger staatlicher Unterstützung gegründet und verfolgt das Ziel, einen „chinesischen GPT-Konkurrenten“ zu schaffen.
Die App kombiniert Sprachverarbeitung, Websuche und Kontexterkennung und wird zunehmend auch in Europa populär – zumindest im privaten Sektor. Der Quellcode ist proprietär, der Datenfluss intransparent.
Kritiker sehen in dem Tool ein trojanisches Pferd, mit dem der chinesische Staat systematisch Informationen aus westlichen Behörden abgreifen könnte – ohne dass die Nutzer es merken.
Souveränität durch IT-Hygiene
Premierminister Petr Fiala sprach nach der Kabinettssitzung Klartext:
„Wir müssen als Staat sicherstellen, dass vertrauliche Informationen nicht in fremde Hände gelangen – weder absichtlich noch durch Unachtsamkeit.“
Das Verbot sei nicht ideologisch motiviert, sondern ein pragmatischer Akt der Selbstverteidigung. „Cybersicherheit ist heute nationale Sicherheit“, sagte Fiala.
Die Maßnahme betrifft nicht nur Ministerien und Behörden, sondern auch Universitäten, staatliche Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Wer künftig beim Login erwischt wird, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen – der Bann ist bindend.
Die deutsche Zurückhaltung – ein Sicherheitsrisiko?
Während Prag vorangeht, hinkt Berlin hinterher. Zwar sind interne Richtlinien für die Nutzung von KI-Tools in einigen Ministerien in Arbeit, doch ein klares Verbot – wie es Tschechien oder die USA erlassen haben – ist bislang nicht absehbar. Auch auf EU-Ebene sind Regelungen zum Einsatz nicht-europäischer KI-Systeme in Behörden noch in der Entwurfsphase.
Das könnte sich als teuer erkaufen lassen. Denn während deutsche IT-Strategen noch abwägen, rüstet China seine Tech-Unternehmen strategisch auf – mit dem Ziel, die Informationsflüsse des Westens zu durchdringen. Für Prag ist das längst keine Theorie mehr, sondern Realität.
Das könnte Sie auch interessieren: