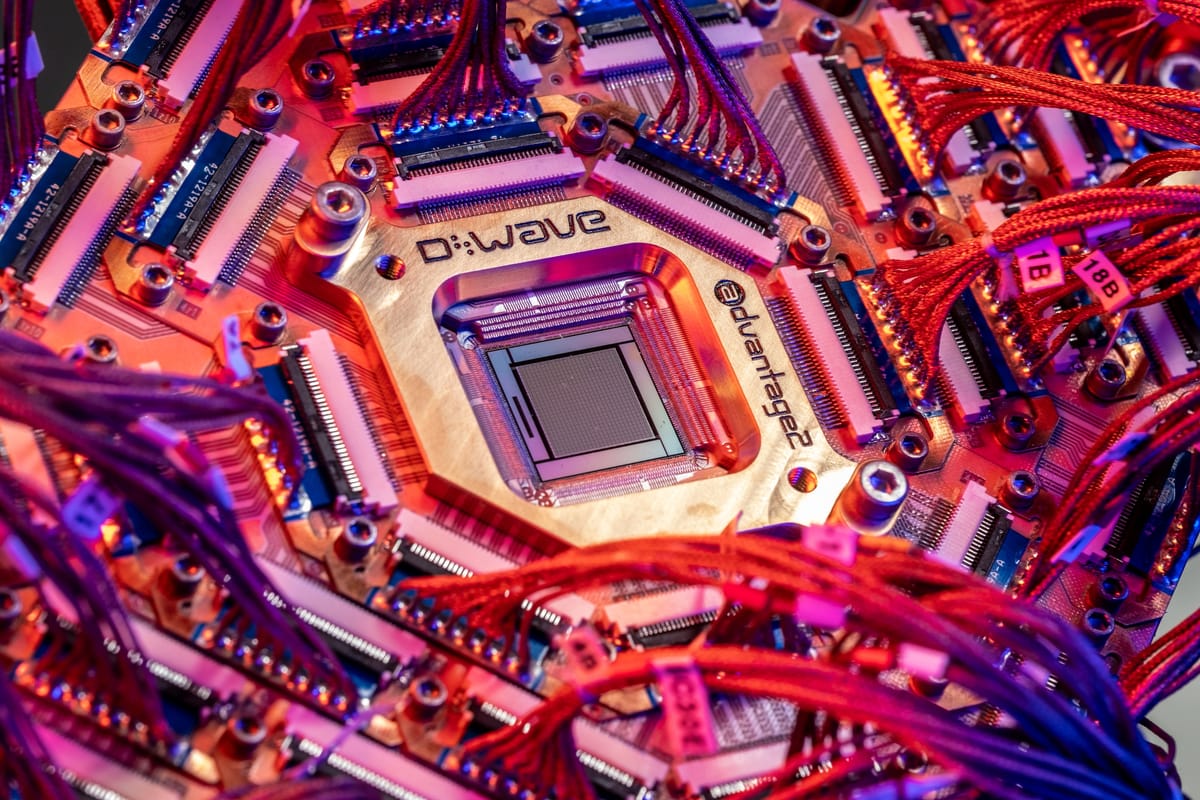Ein Präsident wird Häftling
Kurz nach acht Uhr verlässt Nicolas Sarkozy gemeinsam mit seiner Frau Carla Bruni das Stadthaus im Pariser Nobelviertel. Fotografen, Kameras, ein Blitzlichtgewitter – und ein Präsident, der kein Präsident mehr ist. Wenige Minuten später fällt das schwere Tor des Gefängnisses La Santé hinter ihm ins Schloss.
Dort, im Südosten der Hauptstadt, beginnt für den 70-Jährigen ein neues Kapitel: Häftling, neun Quadratmeter Zelle, Standardausstattung mit Bett, Schreibtisch, Dusche und Fernseher. Keine Sonderbehandlung, kein politisches Privileg. Nur die nüchterne Routine der französischen Justiz – Fingerabdrücke, Foto, Häftlingsnummer.
Der Fall Libyen
Sarkozy wurde Ende September in der sogenannten Libyen-Affäre schuldig gesprochen. Das Gericht befand, er habe versucht, illegale Gelder aus dem Umfeld des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi für seinen Wahlkampf 2007 zu erhalten. Fünf Jahre Haft lautete das Urteil – trotz laufender Berufung.
Für Sarkozy ist das ein politisches Erdbeben. Der einstige Hoffnungsträger der konservativen Rechten sieht sich als Opfer einer Justiz, die es auf ihn abgesehen habe. Auf X schrieb er kurz vor seiner Abfahrt ins Gefängnis, er werde „weiterhin den Justizskandal anprangern“.
Die Richter sahen das anders: Sie ordneten die sofortige Vollstreckung an. Damit wurde Sarkozy zum ersten ehemaligen Staatschef der Nachkriegszeit, der tatsächlich ins Gefängnis muss.
Kein Sonderstatus
In der Haftanstalt La Santé wird Sarkozy in einem besonders geschützten Trakt untergebracht – dort, wo Prominente, Polizisten oder Politiker sitzen, um Übergriffe zu vermeiden. Doch die Zelle bleibt die gleiche: schmal, karg, ohne Privilegien.
Bei der Einlieferung läuft alles nach Protokoll. Fingerabdrücke, Leibesvisitation, Häftlingskarte. Laut französischen Medien hat Sarkozy Hygieneartikel, Bettwäsche und Schreibzeug erhalten. Offenbar will er seine Zeit hinter Gittern nutzen, um ein Buch zu schreiben – über Macht, Gerechtigkeit und das Fallen.

Zwischen Politik und Justiz
Dass ein Präsident ins Gefängnis muss, ist in Frankreich mehr als ein juristischer Vorgang. Es ist ein Symbol – für den Versuch eines Landes, mit seinen alten Machtstrukturen zu brechen.
Justizminister Gérald Darmanin kündigte an, Sarkozy besuchen zu wollen. Präsident Emmanuel Macron soll ihn kurz zuvor im Élysée empfangen haben – ein letztes Treffen, bevor sich die Wege endgültig trennen. Offiziell wollte der Élysée dazu keinen Kommentar abgeben.
Frankreichs schwierige Beziehung zur Macht
Frankreich hat eine lange Tradition mächtiger Präsidenten – und eine ebenso lange Geschichte der Ernüchterung danach. Sarkozy steht nun in einer Reihe mit François Fillon, Jacques Chirac oder jüngst den Affären im Umfeld Macrons. Die Franzosen lieben starke Führungsfiguren – und verurteilen sie, sobald sie zu stark werden.
In den Straßen von Paris herrscht gespannte Neugier. „Das zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht“, sagt ein älterer Mann vor laufender Kamera. Eine junge Frau widerspricht: „Das ist keine Gerechtigkeit, das ist Rache.“
Ein stiller Abgang
Sarkozy könnte seine Strafe bald im Hausarrest verbüßen – das französische Recht erlaubt Häftlingen über 70 eine Haft außerhalb des Gefängnisses. Doch der symbolische Schaden ist angerichtet.
Ein Präsident, der sich selbst als „Retter Frankreichs“ sah, ist nun Häftling Nummer 28745. Ein Land, das sich gern als Wiege des Rechtsstaats versteht, schaut fassungslos zu.
Hinter den Mauern von La Santé bleibt Sarkozy das, was er immer war: kämpferisch, überzeugt von seiner Unschuld – und umgeben von der Bühne, die er nie ganz verlassen wird.