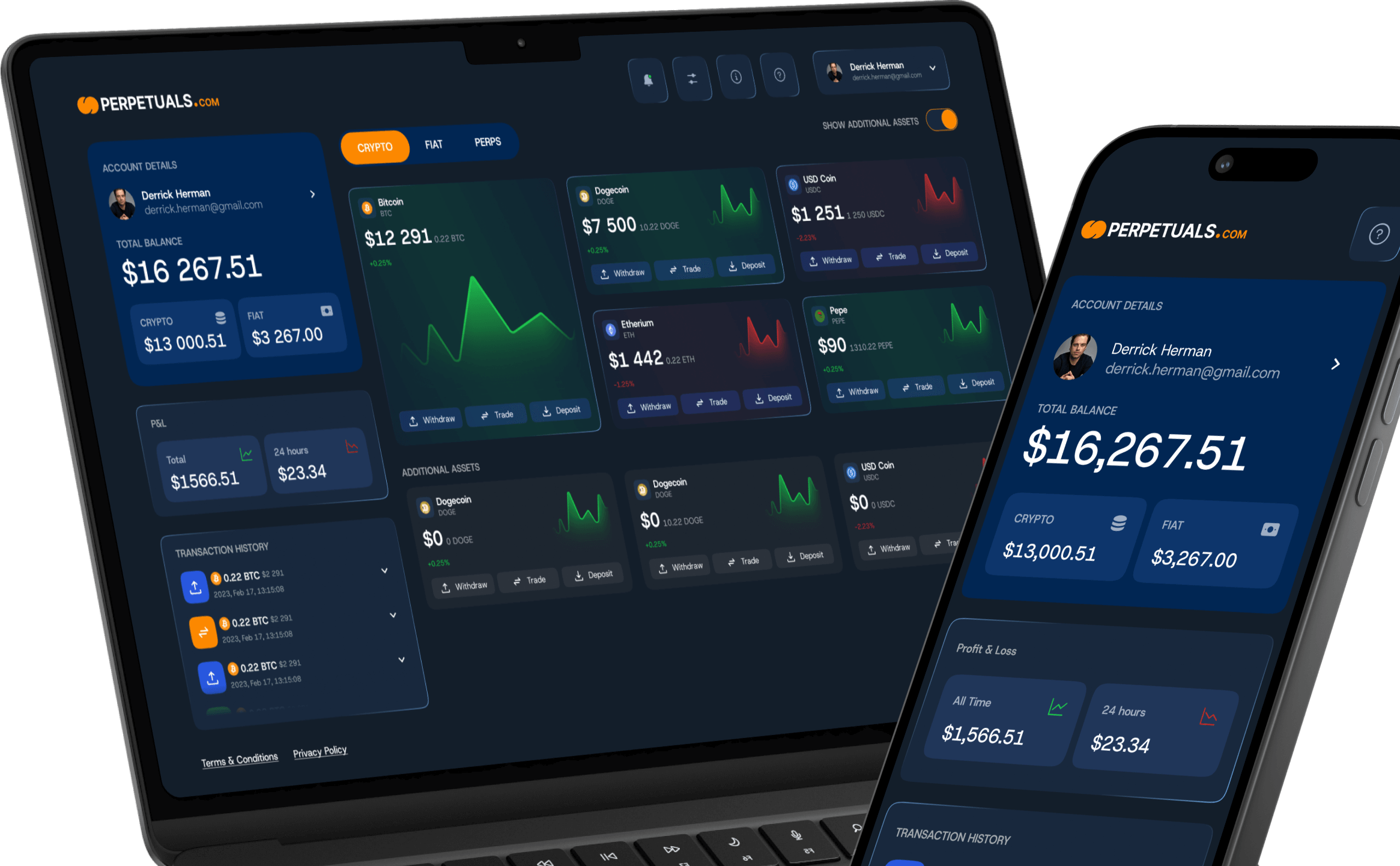Angriff auf den Generationenvertrag
Marcel Fratzscher spart nicht mit drastischen Worten: Die Babyboomer hätten den Generationenvertrag „gebrochen“. Jahrzehntelang hätten sie von günstigen Rentenreformen und steigender Lebenserwartung profitiert, ohne genug Kinder in die Welt zu setzen.
Nun stehe eine Schieflage, die sich vor allem bei den Jüngeren entlade – mit steigenden Beiträgen, wachsender Steuerlast und einem immer späteren Renteneintritt.

Die aktuelle Politik, etwa die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent, bezeichnet Fratzscher als „schlechteste aller Welten“: Weder sichere sie den ärmeren Rentnern ein existenzsicherndes Einkommen, noch entlaste sie die Beitragszahler. Für ihn steht fest: Die bisherige Richtung führt in eine Sackgasse.
Pflichtjahr als „gerechter Ausgleich“
Sein Vorschlag: Rentner sollen ein verpflichtendes Jahr im Sozial- oder Zivilschutzbereich leisten – sei es in der Pflege, im Bildungssektor oder im Katastrophenschutz. Fratzscher argumentiert, die Erfahrung und das Fachwissen älterer Menschen könnten so gesellschaftlich nutzbar gemacht werden. Vor allem aber solle verhindert werden, dass allein die jungen Generationen die Kosten der Alterung tragen.
Die Idee ist provokant. Während Befürworter den Vorstoß als mutigen Denkanstoß feiern, werfen Kritiker dem Ökonomen vor, Senioren zu überlasten und von den eigentlichen Strukturproblemen abzulenken: niedrige Geburtenraten, mangelnde Einwanderungspolitik und ein starres Rentensystem.
„Boomer-Soli“ statt Rentenalter 70
Schon früher hatte Fratzscher eine Sonderabgabe für Besserverdienende im Ruhestand – den sogenannten „Boomer-Soli“ – ins Spiel gebracht. Die Abgabe auf hohe Alterseinkünfte solle kleinere Renten quersubventionieren. CDU-Politiker reagierten darauf mit scharfer Ablehnung, nannten die Idee eine „Geisterfahrt“. Fratzscher dagegen sieht in der Kritik reine Besitzstandswahrung.
Beim Thema Renteneintrittsalter zeigt er sich dagegen zurückhaltend. Zwar müsse das faktische Rentenalter steigen, aber eine pauschale Erhöhung auf 70 Jahre lehnt er ab – zu hoch sei das Risiko von Erwerbsunfähigkeit. Stattdessen fordert er Anreize für längeres Arbeiten und Investitionen in Prävention.

Gesellschaftliche Bruchlinien
Der Vorstoß offenbart eine tiefe gesellschaftliche Bruchlinie: Wer trägt künftig die Hauptlast der demografischen Alterung? Für viele Jüngere, die steigende Sozialabgaben und stagnierende Reallöhne spüren, wirkt die Forderung nach stärkerer Beteiligung der Älteren gerechtfertigt. Für viele Rentner, die ihr Leben lang Beiträge gezahlt haben, ist die Idee hingegen eine Provokation.
Dabei verweist Fratzscher auf internationale Vergleiche: Länder wie Japan oder Schweden hätten gezeigt, dass ein längeres gesellschaftliches Engagement im Alter möglich sei – wenn auch dort freiwillig und nicht als Pflicht.
Zwischen Provokation und Realpolitik
Ob der Vorschlag jemals politische Mehrheiten findet, ist fraglich. Schon jetzt zeigt die Debatte: Fratzscher zwingt Politik und Gesellschaft, über unangenehme Fragen nachzudenken. Der Ökonom greift damit bewusst in ein Tabu ein – und legt den Finger in die Wunde eines Systems, das im aktuellen Zustand nicht zukunftsfähig ist.
Die Pointe: Gerade weil der Pflichtdienst für Rentner unrealistisch wirkt, entfaltet er seine Wirkung. Er zwingt zu einer Debatte über Verantwortung, Besitzstände und die Grenzen des Generationenvertrags.
Das könnte Sie auch interessieren: