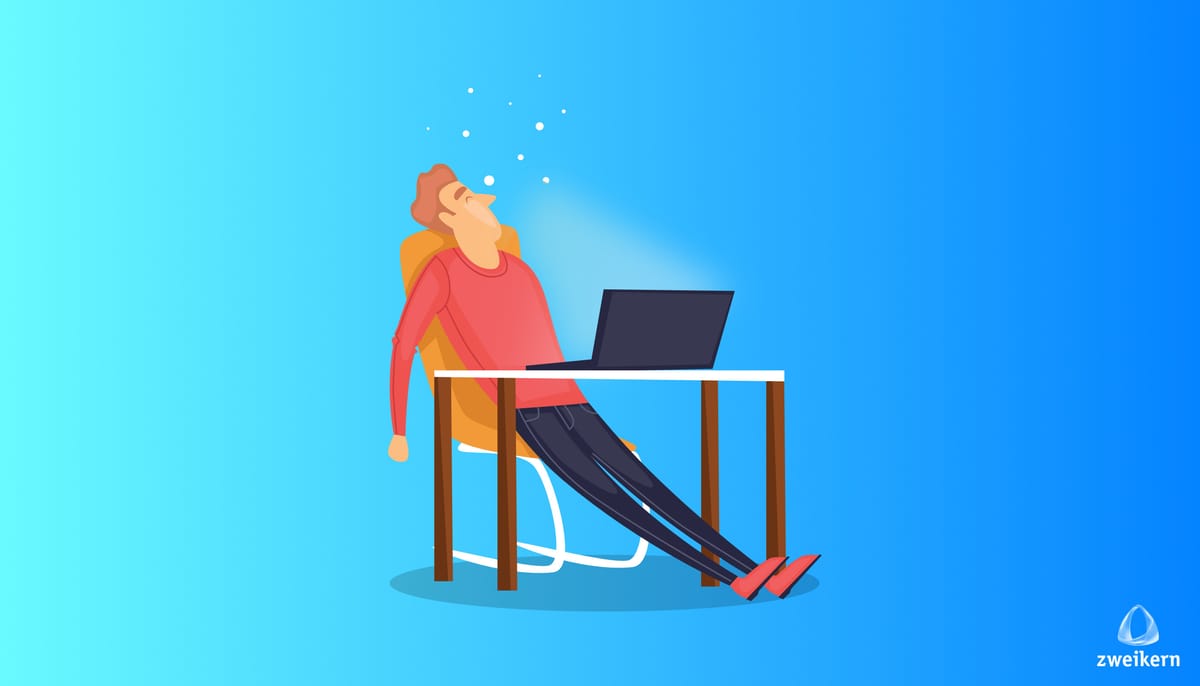Leipzig, 8:35 Uhr
Der Airbus hebt ab – keine Durchsage, kein Blitzlichtgewitter. An Bord: 81 Männer mit afghanischem Pass und krimineller Vergangenheit. Mord, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung, Drogendelikte.
Straftäter, die Deutschland loswerden will – und es in diesem Fall auch tut. Ziel: Kabul. Es ist die erste Sammelabschiebung dieser Größenordnung seit über einem Jahr. Still geplant, straff durchgeführt – und politisch aufgeladen.
Planung unter Verschluss
Die Nachricht von dem Abschiebeflug wurde erst publik, als die Maschine längst über Osteuropa flog. Der Plan war klar: Keine öffentliche Debatte vor dem Abflug, keine Proteste, keine Pannen. Selbst die Bundesländer erfuhren erst zwei Tage vorher von der Aktion. Es sollte reibungslos gehen – und möglichst geräuschlos.
Doch ganz ohne Nebengeräusche kam der Flug nicht aus. Ursprünglich waren rund 100 Männer für die Rückführung vorgesehen. Gelandet sind 81. Einige hatten keine gültigen Papiere. Andere tauchten unter – oder klagten erfolgreich. So bleibt auch dieser Abschiebeflug ein Balanceakt zwischen politischem Willen und juristischer Realität.
Handgeld für Straftäter
Besonders brisant: Jeder der Abgeschobenen bekam bis zu 1.000 Euro „Handgeld“. Die Summe stammt aus einem bundeseinheitlichen Topf, gedacht als Starthilfe – und als juristische Absicherung. Denn ohne Geld könnten Gerichte eine drohende „Verelendung“ im Herkunftsland als Abschiebehindernis werten.
Das sorgt für politischen Unmut. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) zeigt sich fassungslos:
„Es ist mehr als ärgerlich, dass verurteilte Straftäter mit Geld ausgestattet werden.“
Er fordert ein Umdenken in der Rechtsprechung. Zumindest bei Gewalttätern sei diese Praxis „nicht vermittelbar“.
Wer flog – und wer nicht
Die 81 Männer kamen aus mehreren Bundesländern. Baden-Württemberg meldete 13 Personen – darunter ein Mann, der 2018 an einer Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen beteiligt war. Bayern schickte 15 Männer, andere Länder blieben außen vor. Manche, weil sie keine Afghanen in Abschiebehaft hatten. Andere, weil mögliche Kandidaten abgetaucht waren.

Auffällig: Der Wille zur Mitwirkung ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Während einige Innenminister auf die Gelegenheit warteten, machten andere keinen Hehl daraus, dass sie das Verfahren kritisch sehen – oder aus praktischen Gründen nicht mitziehen konnten. Das föderale Nebeneinander zeigt sich auch hier.
Afghanistan als Ziel – trotz Taliban
Dass überhaupt wieder nach Afghanistan abgeschoben wird, ist seit der Machtübernahme der Taliban alles andere als selbstverständlich. Die Lage im Land ist prekär, die Regierung nicht anerkannt, die humanitären Bedingungen teils katastrophal. Abschiebungen dorthin galten lange als tabu.
Doch in der Regierung Merz weht ein anderer Wind. Für den Kanzler ist klar: Wer in Deutschland schwere Straftaten begeht, hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt – Herkunftsland hin oder her. Der Kurs ist hart – und umstritten. Menschenrechtler warnen vor Rückführungen in unsichere Staaten. Juristen verweisen auf Schutzpflichten. Der politische Druck, dennoch zu handeln, ist enorm.
Ein Symbol – mehr nicht
So entschlossen der Flug wirkt: An der Gesamtlage ändert er wenig. Allein in Deutschland leben Zehntausende Afghanen mit Duldung. Die meisten von ihnen sind nicht straffällig – aber ausreisepflichtig.
Wer wie und wann abgeschoben wird, bleibt oft Glückssache. Rechtsstreitigkeiten, fehlende Dokumente, politische Rücksichten – alles Faktoren, die eine konsequente Rückführung erschweren.
Dieser eine Flug ist also kein Strategiewechsel, sondern ein Symbol. Er zeigt, dass Abschiebungen nach Afghanistan wieder möglich sind – unter bestimmten Bedingungen, mit politischer Rückendeckung und juristischer Absicherung. Mehr nicht.
Abschiebung als Politiksignal
Für Innenminister Dobrindt (CSU) ist der Fall klar. Der Staat müsse handlungsfähig bleiben. Besonders bei schweren Straftätern dürfe es keine falsche Rücksicht geben. Der Flug nach Kabul soll nicht der letzte gewesen sein. Weitere könnten folgen – sofern es die Umstände zulassen.
Ob sich das politisch durchsetzen lässt, ist offen. Der Druck auf die Justiz wächst, der Streit um das Handgeld ist entfacht – und die öffentliche Debatte über Migration, Rückführung und Verantwortung nimmt wieder Fahrt auf.
Ein Flug mit Ansage
Die Bundesregierung will Härte zeigen – und hat geliefert. Doch was bleibt, ist ein schaler Beigeschmack. Ein Flug voller Widersprüche: rechtsstaatlich korrekt, aber moralisch umstritten. Diskret geplant, aber politisch aufgeladen. Und mit an Bord: 81 Männer, ein paar Hunderttausend Euro Handgeld – und ein ganzes Land, das weiter um seine Migrationspolitik ringt.
Das könnte Sie auch interessieren: