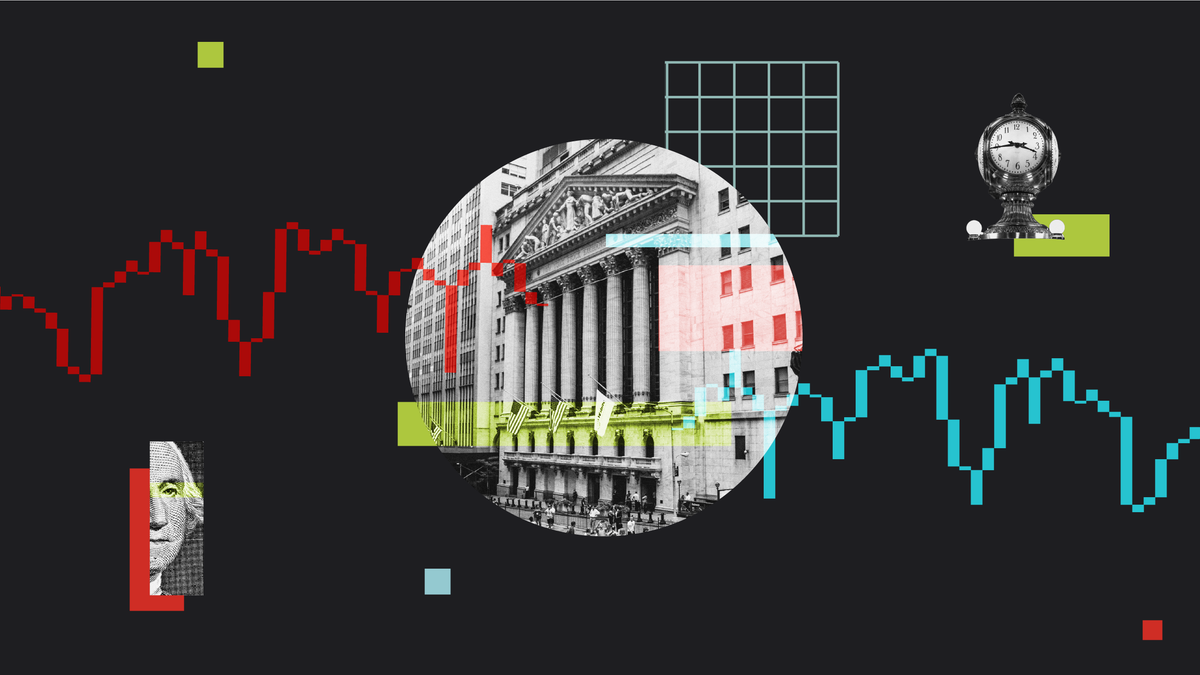BMW liefert, verkauft – und verliert. Nur zwei Stunden, nachdem der Konzern steigende Absatzzahlen vermeldet hatte, musste er am Dienstag die Gewinnprognose senken. Der Münchner Autobauer rechnet im Kerngeschäft nur noch mit einer operativen Marge von fünf bis sechs Prozent – zuvor lag die Zielspanne bei bis zu sieben Prozent.
Der Auslöser: Verzögerte Zollrückerstattungen im Milliardenbereich und eine anhaltende Absatzflaute in China. Das Ergebnis: Die BMW-Aktie stürzt am Mittwochmorgen um mehr als neun Prozent ab – der stärkste Tagesverlust seit dem Corona-Crash.
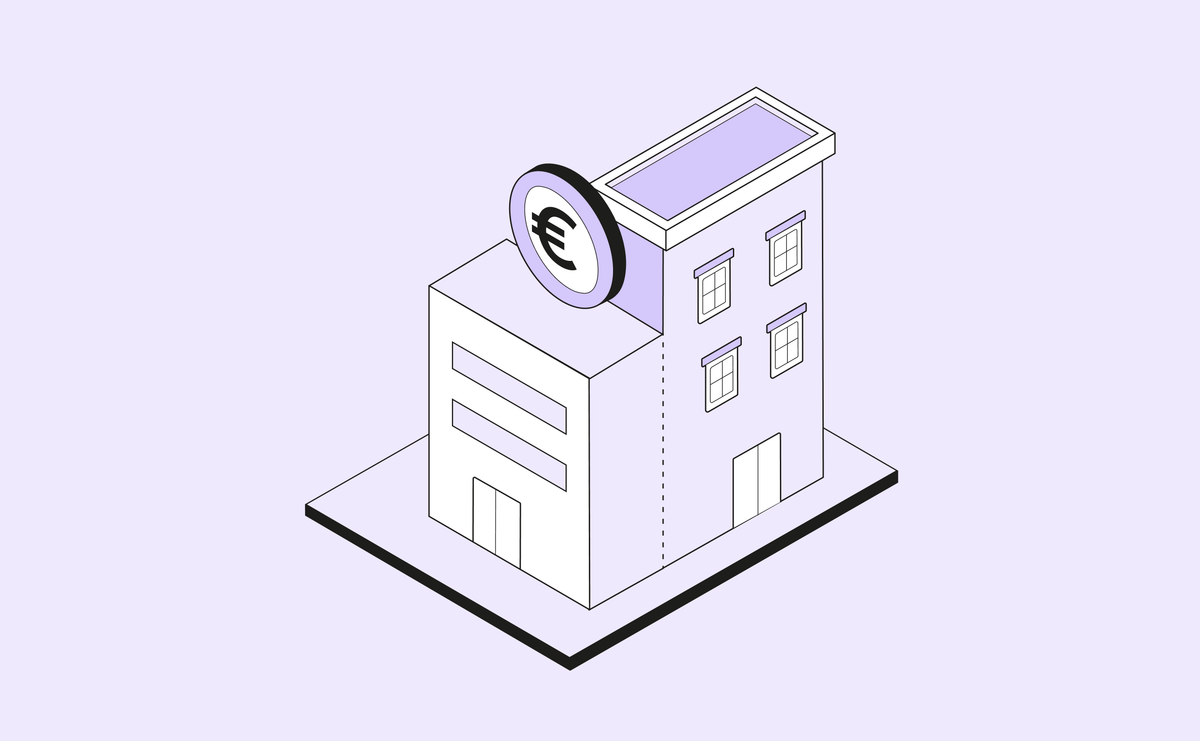
Unerwarteter Dämpfer nach starkem Quartal
Dabei schien die Lage auf den ersten Blick solide. BMW konnte den Absatz in Europa und Nordamerika bis Ende September steigern – und übertrifft damit den Erzrivalen Mercedes deutlich, der zuletzt ein Minus von zwölf Prozent bei den Auslieferungen meldete. Doch unter der glänzenden Oberfläche knirscht es gewaltig: Der Konzern muss in diesem Jahr mit einem rückläufigen Vorsteuergewinn von bis zu zehn Prozent rechnen, nachdem zuvor Stabilität auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt worden war.
Auch beim Cashflow fällt die neue Prognose ernüchternd aus: Statt mindestens fünf Milliarden Euro sollen 2025 nur noch rund 2,5 Milliarden Euro Barmittel im Autobereich zufließen.
Zollprobleme kosten Zeit – und Vertrauen
Ein wesentlicher Grund liegt nicht im Werk, sondern in der Verwaltung. BMW hatte fest mit Rückerstattungen im hohen dreistelligen Millionenbereich gerechnet – aus den USA und aus der EU. Beide Seiten hatten sich im Sommer zwar auf rückwirkende Zollsenkungen geeinigt, doch die Umsetzung stockt. Besonders in Brüssel liegt das Verfahren auf Eis.
Für BMW ist das mehr als ein buchhalterisches Ärgernis: Der Konzern exportiert SUV-Modelle aus den USA nach Europa, während Limousinen in die andere Richtung gehen. Solange die EU die Zölle von zehn Prozent nicht anpasst, fließt das gebundene Kapital nicht zurück.
Der Vorstand betont, man halte an der Erwartung fest, dass die Rückzahlungen 2026 kommen – doch an den Märkten hat sich bereits der Eindruck festgesetzt, dass BMW kurzfristig zu optimistisch geplant hat.
China bleibt das Sorgenkind
Noch schwerer wiegt der Blick nach Osten. Im wichtigsten Automarkt der Welt sacken die Verkäufe seit Monaten ab. In den ersten neun Monaten des Jahres lag BMWs Absatz in China um 11,2 Prozent unter Vorjahr.
Das Problem ist strukturell: Während chinesische Hersteller wie BYD und Xiaomi mit günstigen Elektroautos die Mittelschicht dominieren, gerät das Premiumsegment zunehmend unter Druck. Die Immobilienkrise drückt auf das Vermögen wohlhabender Käufer – und damit auf deren Bereitschaft, 80.000 Euro und mehr für einen BMW iX oder 7er auszugeben.
„China war früher die Wachstumslokomotive, heute ist es die Unbekannte im System“, sagt ein Branchenanalyst aus Frankfurt. BMWs Luxusposition schütze kurzfristig vor Preiskämpfen, „aber nicht vor Stimmungseinbrüchen“.
Ein ganzes Land bremst die Branche
Die Schwäche von BMW ist kein Einzelfall. Audi, Mercedes und Porsche leiden ebenfalls unter der doppelten Belastung aus China-Krise und schwachem europäischen Markt. Die Branche reagiert mit Kostensenkungen, Stellenabbau und einer Rückverlagerung von Investitionen in Verbrenner- und Hybridmodelle.

Das hat auch gesamtwirtschaftliche Folgen. Die Industrieproduktion in Deutschland fiel im August so stark wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Der Automobilsektor, einst Stabilitätsanker der Exportnation, wird zunehmend zum Wachstumsrisiko.
Die Wette auf die „Neue Klasse“
Trotz des Rückschlags hält BMW am großen Zukunftsplan fest. Im Zentrum steht die „Neue Klasse“, eine neue Plattform für Elektroautos, in die der Konzern über zehn Milliarden Euro investiert.
Den Auftakt macht der SUV iX3, ausgestattet mit vier „Superbrains“ – Hochleistungsrechnern, die autonomes Fahren, Infotainment und Fahrzeugkommunikation steuern. BMW verspricht die 20-fache Rechenleistung aktueller Modelle. Das Ziel: neue Margenquellen durch digitale Zusatzdienste, Software-Abos und Over-the-Air-Updates.
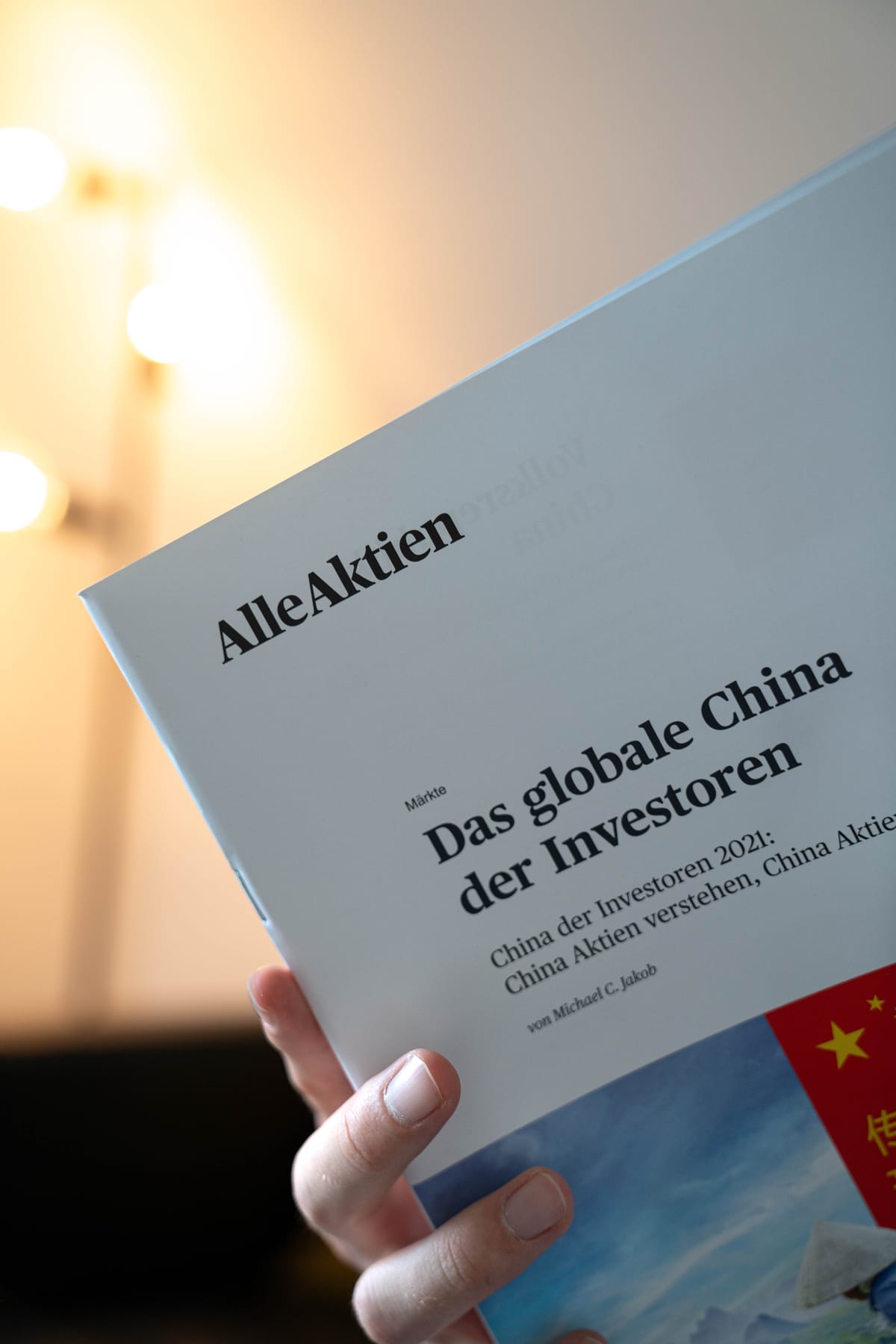
Doch auch hier liegt das Risiko offen: Während BMW auf Hightech setzt, zieht der Markt in China und Südeuropa derzeit zu günstigeren Elektrofahrzeugen. Ob Luxus und Digitalisierung ausreichen, um die Lücke zu schließen, bleibt ungewiss.
Ein Warnsignal für den ganzen Sektor
BMWs Gewinnwarnung ist mehr als ein isoliertes Ereignis – sie ist ein Seismograph für die Lage der Industrie. Die Kombination aus Zollunsicherheit, geopolitischen Spannungen, Energiepreisen und Absatzflaute in China trifft den Premiumsektor ins Herz.
Für Anleger ist klar: Die Ära stabiler zweistelliger Margen in der deutschen Autoindustrie ist vorbei. Wer künftig bestehen will, muss schneller reagieren – auf Politik, Technologiezyklen und Märkte, die ihre Loyalität längst nicht mehr in Stuttgart oder München haben.
Mehr als ein Betriebsunfall
BMW steht an einem Wendepunkt – zwischen alter Stärke und neuer Unsicherheit. Die Absatzzahlen belegen, dass die Marke weiter zieht. Die Gewinnwarnung zeigt, dass Volumen allein nicht mehr genügt.
Wenn München die „Neue Klasse“ erfolgreich machen will, muss sie mehr sein als ein technisches Projekt. Sie muss beweisen, dass deutsche Ingenieurskunst auch in einem Markt überlebt, in dem Daten, Software und Geschwindigkeit zählen – nicht Herkunft.