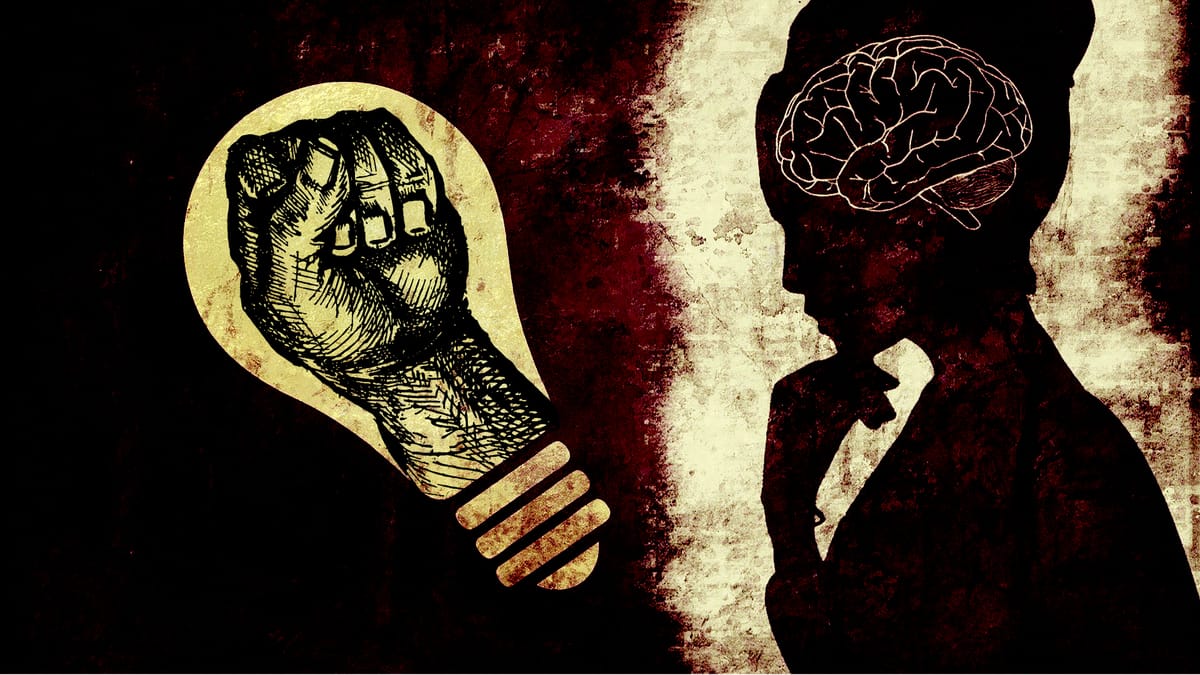Krisenfest auf Knopfdruck?
„Bleib gelassen.“ „Atme durch.“ „Akzeptiere Veränderung.“ Die Empfehlungen klingen harmlos – und oft auch hilflos. In Ratgeberbüchern, Podcasts und Coachings wird Resilienz als persönliche Ressource vermarktet, die sich mit ein wenig Achtsamkeit und mentaler Hygiene beliebig ausbauen lasse.
In der Realität, zwischen Projektchaos, Personalmangel und Kündigungswelle, stellt sich eine andere Frage: Wer hat überhaupt die Zeit – oder die Kraft – zum Resilientsein?
Der Ruf nach psychischer Widerstandsfähigkeit zieht sich inzwischen durch ganze Branchen. In Jobanzeigen wird sie gefordert, in Seminaren trainiert, in Führungskräften als Ideal gepflegt. Doch wo endet persönliche Verantwortung – und wo beginnt strukturelle Überforderung?
Die Wissenschaft hinter der Widerstandskraft
Der Begriff „Resilienz“ stammt ursprünglich aus der Materialforschung: die Fähigkeit eines Stoffes, nach Belastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
Psychologisch beschreibt er heute die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen, sich anzupassen und nicht dauerhaft aus der Bahn geworfen zu werden. Die Forschung kennt inzwischen zahlreiche Einflussfaktoren: genetische Disposition, Persönlichkeit, soziale Einflüsse, frühkindliche Erfahrungen.
Die US-Psychologin Emmy Werner zeigte in der berühmten Kauai-Studie, dass etwa ein Drittel der Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen trotz widriger Umstände zu psychisch stabilen Erwachsenen heranwuchs – wenn sie wenigstens eine stabile Bezugsperson hatten. Kein Yoga, kein Coaching – sondern eine verlässliche Tante oder eine verständnisvolle Lehrerin.
„Werner hat gezeigt, dass Resilienz vor allem dann entsteht, wenn soziale Unterstützung vorhanden ist“, sagt Thomas Rigotti, Professor für Arbeitspsychologie am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. In seiner Forschung betont er immer wieder: „Man kann nicht alles wegatmen. Ein resilientes Umfeld ist genauso entscheidend wie individuelle Strategien.“

Die Mär vom unerschütterlichen Individuum
Doch genau dieser Gedanke geht in der wirtschaftlichen Realität oft verloren. Viele Firmen setzen in erster Linie auf Verhaltensprävention – also individuelle Resilienztrainings, Achtsamkeitsübungen, Apps. Was fehlt, ist die Verhältnisprävention: bessere Arbeitsbedingungen, faire Führung, Schutz vor Überlastung.
Rigotti warnt: „Solche Maßnahmen wirken nur begrenzt und vor allem kurzfristig. Was wirklich zählt, ist das Verhältnis von Anforderungen und Ressourcen am Arbeitsplatz.“ Wer permanent unter Druck steht, keine Anerkennung erfährt und keine Einflussmöglichkeiten hat, könne auch mit dem besten Coaching nicht dauerhaft stabil bleiben.
Resilienz beginnt in der Kindheit – aber endet nicht dort
Ein weiterer Befund aus der Forschung: Der Grundstein für psychische Widerstandskraft wird früh gelegt – aber er ist veränderbar. „Resilienz ist zu etwa einem Viertel genetisch bedingt“, schätzt Rigotti.
„Der größere Anteil ergibt sich aus Lebensstil, Erfahrungen und sozialem Umfeld.“
Entscheidend sei, dass Menschen im Laufe ihres Lebens wiederholt Herausforderungen bewältigen – und so Selbstwirksamkeit erleben.
Die Schattenseite: Überbehütung in der Kindheit oder ein überkontrolliertes Arbeitsumfeld können diese Entwicklung ausbremsen. „Wenn man nie gelernt hat, kleine Krisen zu bewältigen, wird man mit großen schwerer klarkommen“, sagt Rigotti.

Das Problem mit dem Coaching-Hype
Viele Resilienztrainings versprechen viel – und liefern wenig. Zwar zeigen Studien, dass sie kurzfristig zu besserem Wohlbefinden führen können. Doch die Effekte sind oft klein und verflüchtigen sich schnell.
„Die meisten Trainings sind symptomorientiert“, so Rigotti. „Sie helfen vielleicht bei akutem Stress, lösen aber keine strukturellen Ursachen.“
Dazu kommt: Wer als Einzelperson ständig an sich arbeiten muss, bekommt irgendwann das Gefühl, selbst das Problem zu sein. „Resilienz darf keine neue Form der Selbstoptimierung sein, bei der man eigene Belastungsgrenzen ignoriert“, warnt Rigotti. „Manche Coachingangebote tragen eher zur Erschöpfung bei, als sie zu verhindern.“
Was wirklich hilft
Die Forschung kennt einige wirksame Schutzfaktoren: Optimismus, soziale Unterstützung, ein Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben. Entscheidend ist aber vor allem das Kohärenzgefühl – ein Begriff, den der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky prägte. Wer sein Leben als sinnvoll, verstehbar und bewältigbar empfindet, ist deutlich besser gegen Stress gewappnet.
„Das Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, Aufgaben zu verstehen und Sinn zu empfinden – das ist der Schlüssel“, erklärt Rigotti. Und genau das können auch Unternehmen fördern. Zum Beispiel, indem sie Transparenz schaffen, Verantwortung übergeben, Erfolge sichtbar machen.
Führung als Resilienzfaktor
Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle. Nicht nur, weil sie Aufgaben verteilen, sondern weil sie Orientierung geben – oder eben nicht. Studien zeigen: Mitarbeitende, die sich ernst genommen fühlen, sich einbringen können und Rückhalt haben, sind belastbarer. „Wer immer nur Druck macht und keine Spielräume lässt, zerstört Resilienz“, so Rigotti.
Was es braucht, ist ein kultureller Wandel: Weg vom Ideal der stoischen Einzelkämpferin, hin zu einer Haltung, die Belastung anerkennt – und gezielt ausgleicht. Dazu gehört auch, Grenzen zu akzeptieren. Denn Resilienz ist nicht unendliche Belastbarkeit. Sie ist die Fähigkeit, sich zu erholen – nicht, sich aufzugeben.
Das könnte Sie auch interessieren: