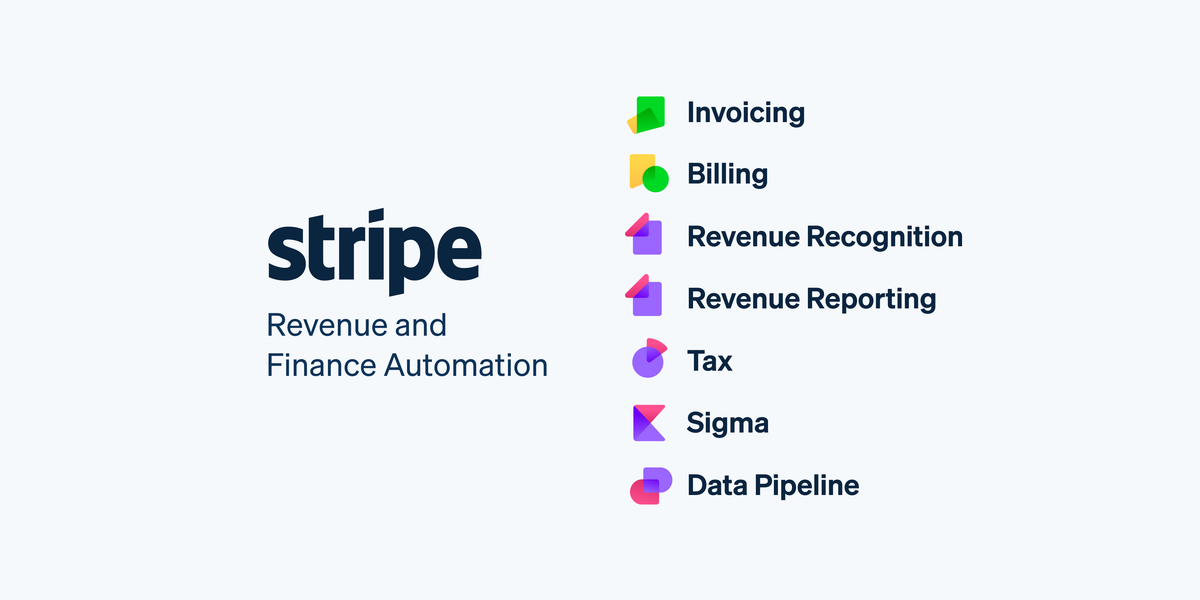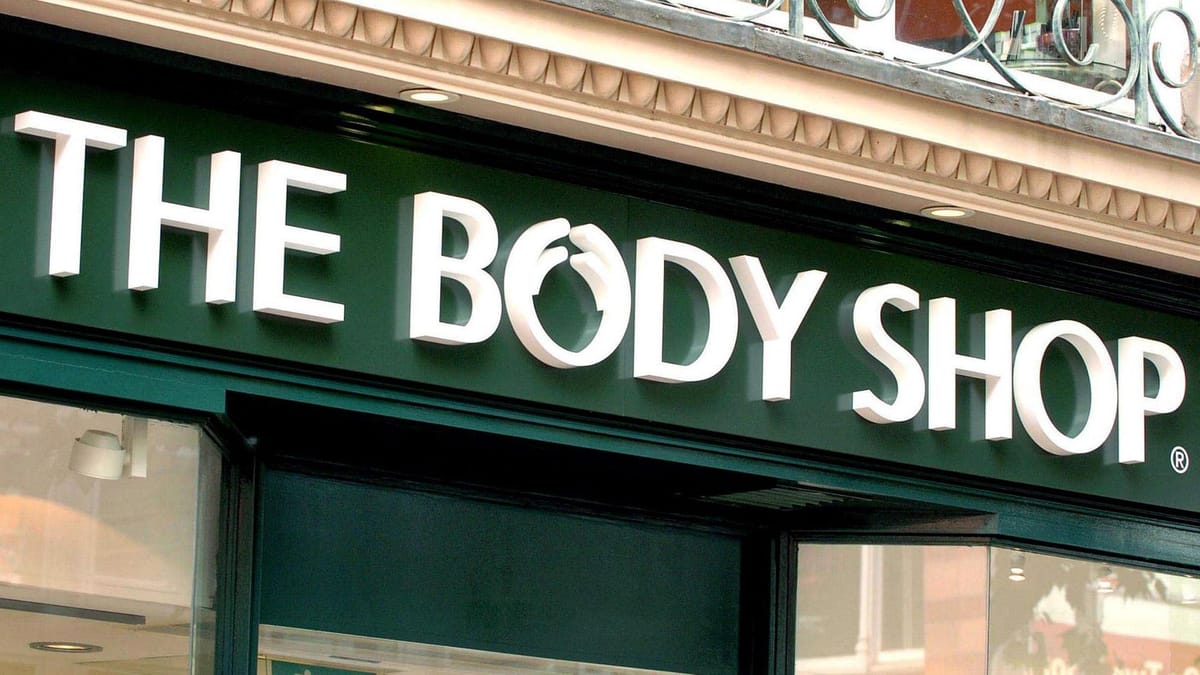Im Hinterhof von Düsseldorf beginnt die Wende. Wo vor einem Jahr Serverzugänge hingen, Rechnungen stockten und das WLAN ausfiel, plant The Body Shop Deutschland heute wieder Eröffnungstermine und Listungen im Handel. Die Marke, die mit nachfüllbaren Flaschen, Ethos und „Ruby“ einst zur Ikone wurde, war 2024 operativ am Ende.
Seit der Übernahme durch Investor Stefan Herzberg im Herbst desselben Jahres läuft der Neustart – mit frischer Logistik, neuen Vertriebskanälen und einem klaren Fokus: weniger Pathos, mehr Performance.
Sanierung mit kurzen Wegen
Herzberg hat nach der Trennung von der britischen Kerngesellschaft ein eigenständiges Deutschland-Modell aufgesetzt: zentrale Systeme auf eigener Infrastruktur, ein Warenlager in Frankfurt, ein kompaktes Management um Geschäftsführerin Anita Camaiani und Marketingchefin Larissa Pape.
Viele Entscheidungen, die früher über London gingen, fallen jetzt in Düsseldorf – und zwar schnell. Das reduziert Reibung, senkt Kosten und schafft Handlungsfähigkeit, die im Nonfood-Einzelhandel überlebenswichtig ist.

Von 45 auf 26 Filialen – und wieder nach vorn
Die harte Bereinigung des Filialnetzes ist vollzogen: 26 Stores blieben, weitere Standorte sind in Vorbereitung. Für 2026 werden Ladenflächen in Stuttgart, Frankfurt, München, Bochum und Düsseldorf geprüft. Der Anspruch ist nüchtern: frequenzstarke Lagen, kleinere Flächen, hohe Drehzahlen. Das stationäre Geschäft liefert Sichtbarkeit und Markenbindung – der Umsatzschub kommt aber nicht mehr nur über den eigenen Shop.
Regal statt Schaufenster: in die Fläche mit Lebensmitteleinzelhandel
Der strategische Hebel liegt im Multichannel-Vertrieb. Erste Produkte sind bereits in rund 50 Supermärkten von Rewe, Edeka und Marktkauf gelistet. Der Effekt: Konsequente Präsenz im täglichen Einkauf, bessere Warenverfügbarkeit und geringere Abhängigkeit von Laufkundschaft.
Ergänzend kooperiert The Body Shop mit Plattformen – von Versandapotheke bis Quick-Commerce. Für eine Marke, die lange „nur“ Flagship und Onlineshop kannte, ist das eine überfällige Öffnung der Absatzkanäle.
Nachhaltigkeit als Asset – aber anders erzählt
Die Gründer-DNA bleibt wertvoll, doch sie verkauft sich nicht mehr von allein. Seit der Inflationswelle ist die Zahlungsbereitschaft für „grün“ gesunken. Die Antwort: Bezahlbare Klassiker und Sets, sichtbar platzierte Nachfüllformate, klare Claims statt Moral. Nachhaltigkeit wird in Nutzen übersetzt: Hautgefühl, Haltbarkeit, Preis-Leistung. Die symbolträchtige „Ruby“ steht weiter für Haltung – das Preisschild entscheidet über den Warenkorb.
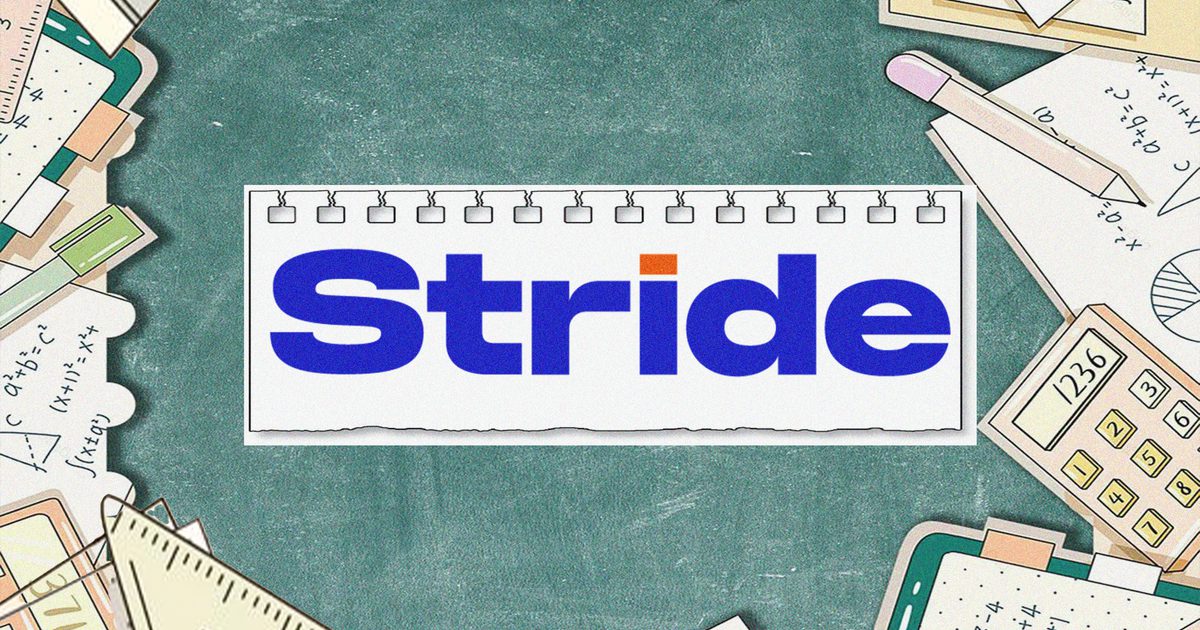
Gen Z gewinnen: Content vor Kampagne
Die Zielgruppe unter 25 Jahren ist kein Selbstläufer. Pape setzt auf Creator-Kooperationen und testet Taktungen, die im Social Commerce funktionieren: kurze Tutorials, ehrliche Routinen, UGC statt Hochglanz.
TikTok ist Startpunkt, Instagram folgt. Wichtig ist die Brücke in den Handel: Wer im Feed konvertiert, soll Produkte nahe kaufen können – online, in der Drogerieecke des Supermarkts oder im City-Store. Sichtbarkeit ohne Kaufmöglichkeit ist in dieser Kohorte verbranntes Budget.
Operatives Rückgrat: Systeme, Service, Supply
Der Turnaround steht auf drei Säulen. Erstens die IT: eigenständig, skalierbar, mit POS und CRM aus einem Guss. Zweitens der Service: direkter Draht in die Stores, kurze Eskalationswege, Standardanfragen automatisiert – komplexe Fälle mit Verantwortlichen, die entscheiden dürfen. Drittens die Supply Chain: Frankfurt als Knoten, belastbares Bestandsmanagement für Peak-Zeiten. Denn was in der Insolvenzphase am härtesten schmerzte, war die Leere im Regal.
Internationales Kapitel: kleine Schritte, klare Kontrolle
Neben Deutschland steuert Herzberg bereits Niederlande, Belgien und die Schweiz als Franchise-Märkte. Der Plan ist pragmatisch: erst Verfügbarkeit sichern, dann Sortiment vertiefen, erst danach größere Marketingwellen fahren. Die neue Struktur erlaubt Roll-outs aus einem Lager – mit Sortimentskernen, die in allen Märkten funktionieren, und nationalen Akzenten, wo es Sinn ergibt.
Risiko-Check: drei Fallstricke
Erstens die Preissensibilität: Wenn die Konsumlaune weiter flach bleibt, müssen Sets und Einstiegspreispunkte noch präziser kuratiert werden. Zweitens die Kanalkomplexität: Je mehr Partner im Spiel sind, desto wichtiger wird die Marge nach Retouren, Fees und Promo. Drittens die Markenführung: Wer überall präsent ist, muss überall gleich klingen – sonst zerfasert die Identität. Die Gegenmittel sind klar: datenbasierte Sortimentspflege, knallhartes Konditionenmanagement, eine Tonalität für alle Kanäle.
Warum der Neustart diesmal Chancen hat
Die Marke ist bekannt, die Fanbasis loyal, das Sortiment erweiterbar – von Body Butter bis Skin Care. Was fehlte, war eine Organisation, die schneller entscheidet als sie kommuniziert. Genau das hat das neue Team gedreht. The Body Shop verzichtet auf Durchhalteparolen, liefert lieber: listet Produkte, baut Systeme, gewinnt Flächen. So entstehen Vertrauen und Tempo – die zwei Währungen, die nach einer Insolvenz zählen.