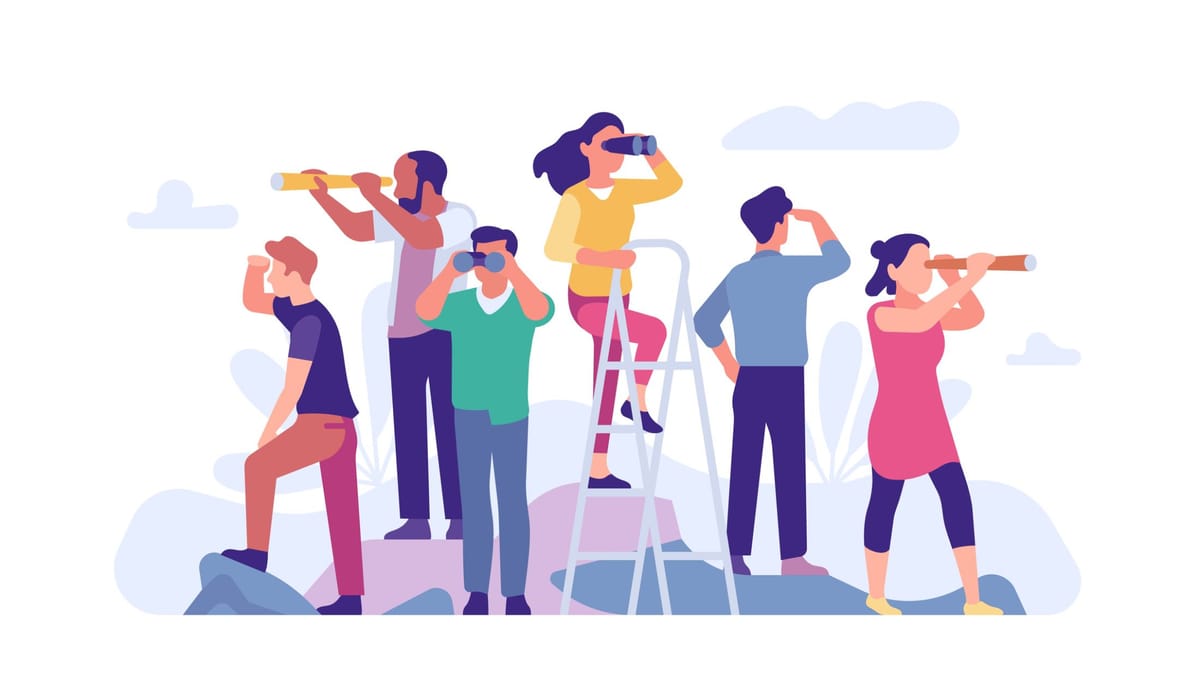Ein Land voller „Job-Hugger“
Saskia Bülow kennt die Symptome: Schlaflose Nächte, Unlust auf den Büroalltag, ein Lächeln, das längst zur Maske geworden ist. Als Wirtschaftspsychologin und Coachin erlebt sie derzeit, was sie „eine Welle der Angststarre“ nennt. Ihre Klienten wechseln nicht mehr den Job – sie umarmen ihn. Wörtlich. Auf TikTok kursieren Videos, in denen junge Angestellte lachend ihre Bürostühle umarmen. Der Trend hat einen Namen: Job-Hugging.
Was harmlos klingt, ist Ausdruck einer stillen Krise am deutschen Arbeitsmarkt. Menschen bleiben, obwohl sie längst innerlich gekündigt haben. Sie arbeiten weiter, brav und korrekt, aber ohne Leidenschaft. Nicht aus Loyalität – sondern aus Angst.

Wirtschaftliche Unsicherheit lähmt die Wechselbereitschaft
Die Furcht ist nicht unbegründet. Bosch streicht Stellen, Lufthansa reduziert Personal, VW kürzt Schichten und der Traditionshersteller Staedtler schließt gleich zwei Werke. Die Zahl offener Stellen sinkt, während die Konjunktur stagniert.
„Viele meiner Klienten sagen, sie hätten Angst, woanders keine Stelle zu finden – besonders, wenn sie schon einmal von einer Krise betroffen waren“, erklärt Bülow.
Zahlen bestätigen das: Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stagnieren Einstellungen seit 2023, während Kündigungen zurückgehen. Arbeitnehmer klammern sich an das, was sie haben. Selbst dann, wenn es ihnen schadet.
Hinzu kommt der finanzielle Druck. Hohe Mieten und Lebenshaltungskosten machen es riskant, den Job zu wechseln. „Sicherheit ist für viele zur Währung geworden“, sagt Bülow.
Generation Z: Die Job-Hopper werden zu Huggern
Besonders überraschend ist, dass der Trend bei jungen Arbeitnehmern am stärksten ausgeprägt ist. Laut einer Appinio-Studie will jeder fünfte Beschäftigte trotz Unzufriedenheit nicht kündigen – unter den Jüngeren sogar mehr. Die Generation, die einst für Flexibilität und Selbstverwirklichung stand, klammert sich nun an befristete Verträge und stabile Einkommen.

Arbeitsforscher Hans Rusinek von der Universität St. Gallen erkennt darin ein Warnsignal: „Wenn ganze Teams aus Job-Huggern bestehen, droht Stillstand. Innovation und Veränderungsbereitschaft gehen verloren.“
Die unterschätzte Gefahr für Unternehmen
Nach außen wirken Job-Hugger oft wie engagierte Mitarbeiter – pünktlich, zuverlässig, konfliktfrei. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Viele sind ausgebrannt, frustriert oder innerlich abwesend. „Das ist kein offener Protest, sondern eine stille Erosion“, warnt Rusinek.
Während beim „Quiet Quitting“ Beschäftigte bewusst nur das Nötigste tun, zeigen Hugger ein anderes Verhalten: Sie bleiben pflichtbewusst – aber aus Angst, nicht aus Motivation. Die Folge: sinkende Kreativität, weniger Eigeninitiative, ein Klima des Schweigens.
In Teams, in denen diese Haltung überhandnimmt, gerät das ganze System ins Stocken. Führungskräfte bemerken den Wandel oft erst, wenn Leistung und Stimmung kippen.
Gesundheitliche Folgen: Wenn Festhalten krank macht
Das Verharren in ungeliebten Jobs bleibt nicht folgenlos. Laut AOK-Fehlzeitenreport steigt bei unzufriedenen Beschäftigten das Risiko für psychische Erkrankungen, Schlafstörungen und depressive Symptome deutlich an. Auch körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Magenprobleme häufen sich.
Wer über Jahre in einem Job bleibt, der ihn über- oder unterfordert, verliert nicht nur Energie, sondern auch Perspektive. „Berufliche Stagnation ist Gift für die Entwicklung“, warnt Rusinek. Fehlende Lernchancen, verpasste Netzwerke und das langsame Veralten von Fähigkeiten seien die langfristigen Risiken.
Was Führungskräfte jetzt tun müssen
Für Unternehmen ist die Erkenntnis unbequem: Sie müssen nicht nur neue Talente gewinnen, sondern auch die stillen Verbliebenen neu entfachen. Coachin Bülow rät, sensibel auf Warnsignale zu achten – etwa wenn Mitarbeitende weniger Eigeninitiative zeigen oder emotional auf Distanz gehen.
„Führungskräfte müssen Unsicherheit erkennen, bevor sie in Lethargie umschlägt“, sagt sie. Das gelingt nur durch ehrliche Gespräche, klare Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Neue Aufgaben, Weiterbildungen oder flexible Arbeitsmodelle können helfen, Vertrauen und Motivation zurückzubringen.
Der Appell: Mut statt Angst
Der deutsche Arbeitsmarkt steht an einem psychologischen Wendepunkt. Während die Wirtschaft schwächelt, wächst der Wunsch nach Sicherheit – und mit ihm die Gefahr der Selbstblockade. Unternehmen riskieren ganze Abteilungen voller „Hugger“, die zwar funktionieren, aber nicht mehr gestalten.
Für Arbeitnehmer gilt das Gleiche: Wer zu lange bleibt, verliert sich selbst. Die Lektion lautet nicht, blind zu kündigen – sondern mutig zu prüfen, wo Stillstand beginnt.
Denn eines ist sicher: Wer sich zu fest an seinen Bürostuhl klammert, steht irgendwann nicht mehr auf.