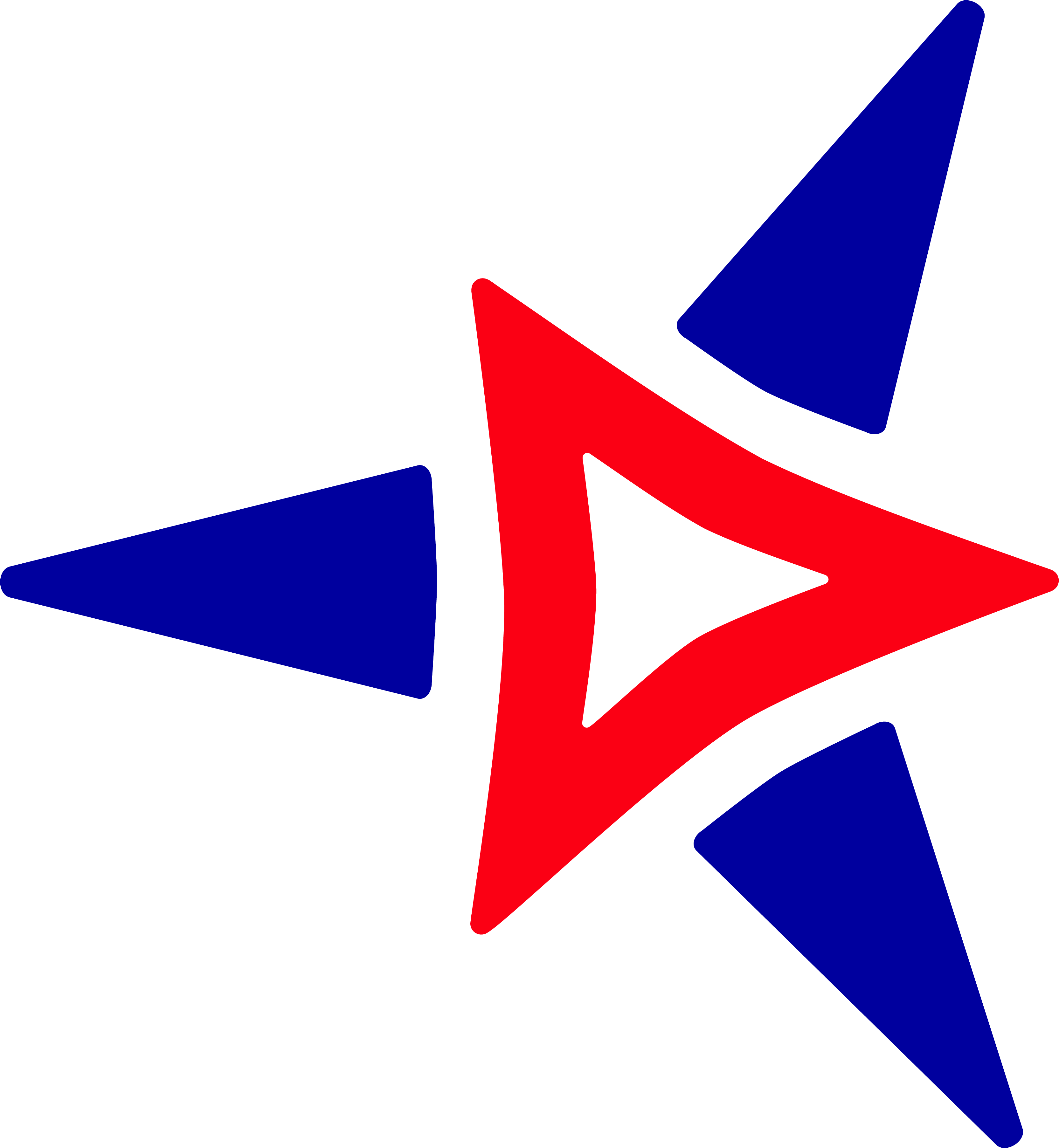Basel schreibt Stromgeschichte – zum zweiten Mal
Kein anderer Ort symbolisiert Europas Energieintegration so wie Laufenburg. Dort, wo seit 1958 das erste internationale Stromnetz Europas entstand, soll nun das nächste Kapitel geschrieben werden – nicht mit neuen Kraftwerken, sondern mit der größten Batterie der Welt.
Das Schweizer Unternehmen Flexbase baut in Laufenburg einen Stromspeicher der Superlative: 1,6 Gigawattstunden Speicherkapazität, 800 Megawatt Leistung. Der Speicher könnte Basel mitsamt Chemieindustrie fünf Stunden lang komplett mit Strom versorgen. Damit übertrifft das Projekt selbst Chinas bisherige Rekordanlagen – und markiert einen Paradigmenwechsel im Strommarkt.

Warum diese Batterie alles verändert
Batteriespeicher galten bislang als teure Nischenlösung für Netzstabilität – technisch wertvoll, wirtschaftlich zweifelhaft. Doch das ändert sich rasant. Die geplante Großbatterie in Basel basiert auf einer völlig anderen Technologie als klassische Lithium-Ionen-Akkus: Redox-Flow-Batterien.
Statt fester Elektroden speichern diese Energie in flüssigen Elektrolyten, die in riesigen Stahltanks zirkulieren.
Der Vorteil: Fast unbegrenzte Lebensdauer, niedrige Materialkosten – und ein entscheidender ökonomischer Hebel. Denn bei zunehmender Größe sinkt der Preis pro gespeicherter Kilowattstunde. Skaleneffekte, wie sie sonst nur in der Petrochemie bekannt sind.
Günstiger, haltbarer, skalierbar
Redox-Flow-Batterien benötigen keine kritischen Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium. Stattdessen kommen preiswerte Eisensalze oder Vanadium zum Einsatz – gelöst in Wasser.

Das senkt die Materialkosten um bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Und: Die Tanks lassen sich einfach vergrößern, ohne dass die Elektronik überfordert wird.
Hinzu kommt die lange Lebensdauer. Während Lithium-Zellen nach 10 bis 15 Jahren ausgetauscht werden müssen, laufen Redox-Flow-Speicher laut Herstellerangaben 25 bis 30 Jahre – nahezu wartungsfrei.
Basel statt Gaskraftwerke?
Die Basler Megabatterie fällt in eine Zeit, in der Europas Energiesystem vor einem Richtungsentscheid steht. Die neue Energieministerin Katherina Reiche will massiv in Gaskraftwerke investieren, um die Stromversorgung bei Dunkelflauten abzusichern. Doch genau dieses Argument gerät durch Projekte wie Laufenburg ins Wanken.
Batterien können inzwischen nicht nur Regelleistung liefern, sondern auch Speicherzeiten von mehreren Stunden – und bald Tagen – wirtschaftlich abbilden. Was früher Pumpspeicherwerken oder Gaskraftwerken vorbehalten war, wird nun auch durch stationäre Batterien möglich.
Vom Netzpuffer zum echten Stromspeicher
„Bisher war der Einsatzbereich von Batterien technisch eng begrenzt“, sagt Energieökonom Lion Hirth. „Mit Großspeichern wie in Laufenburg wird es erstmals möglich, nicht nur Regelleistung bereitzustellen, sondern auch Strompreisschwankungen im Stunden- und Tageshandel gezielt abzufedern.“
Was heute noch als Leuchtturmprojekt gilt, könnte bald Standard werden. In den USA, China und nun auch Europa entstehen die ersten batteriegestützten Netzinfrastrukturen mit mehreren Gigawattstunden.

Ein Energiesystem ohne Turbinen?
Die politische Dimension ist erheblich. Gaskraftwerke mit 20 Jahren Abschreibungszeit rechnen sich nur, wenn sie regelmäßig laufen – was jedoch im Widerspruch zum Ziel steht, die CO₂-Emissionen zu senken. Großbatterien könnten diesen Zielkonflikt entschärfen.
„Was jetzt entsteht, ist ein zweites Stromsystem: flexibel, emissionsfrei, modular“, sagt Michael Liebreich, Gründer des Beratungsunternehmens Liebreich Associates. „Die Schweiz zeigt mit Laufenburg, dass die Technologie dafür da ist.“
Und Deutschland?
Auch in Deutschland laufen erste Projekte mit Redox-Flow-Batterien an – zum Beispiel in Boxberg in der Lausitz. Dort will der Versorger LEAG ab 2027 einen Speicher mit 500 MWh Kapazität errichten – kombiniert mit einer klassischen Lithium-Batterie für kurzfristige Regelleistung und einem Wasserstoffkraftwerk für saisonale Speicherung.
Die Botschaft ist klar: Die Zukunft der Energieversorgung wird nicht mehr nur in Kraftwerksblöcken gedacht, sondern in flexiblen, vernetzten Systemen – aus Sonne, Wind, KI, Wasserstoff und nun auch: Batterie-Stahl.