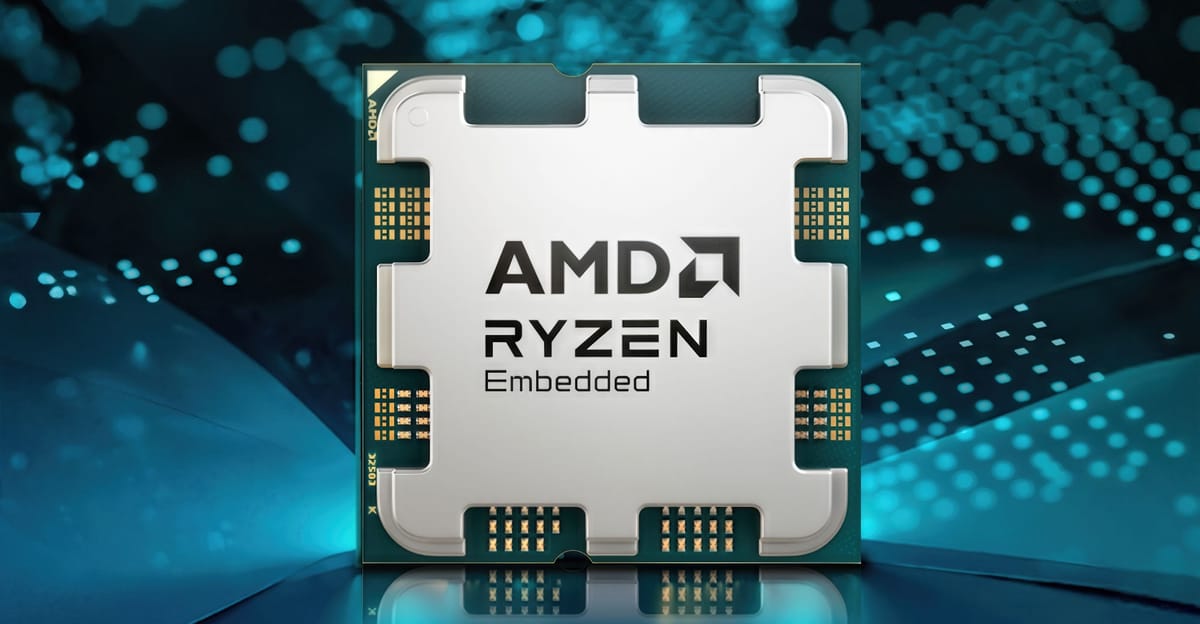Es geht ans Eingemachte
Kein Vorlauf, keine Schönfärberei: Die Bundesregierung greift tief ins Gesundheitssystem ein. Um eine zwei Milliarden Euro große Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenkassen zu schließen, hat der Bundestag ein Sparpaket verabschiedet, das direkt an den Kostenblöcken ansetzt – Kliniken und Krankenkassen.
Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verkauft das Paket als Schutzschild für Beitragszahler: Die Zusatzbeiträge sollen im kommenden Jahr nicht steigen. Erstmals seit 2019 könnte der Beitragssatz stabil bleiben – so das politische Versprechen.
Doch schon in der Debatte zeigte sich, wie dünn die Eisfläche ist, auf der diese Stabilität steht.
Kliniken sollen 1,8 Milliarden Euro schlucken
Die größte Last tragen die Krankenhäuser. Ihre Vergütungen dürfen nur noch im Rahmen der realen Kostensteigerung wachsen. Für ein System, das vielerorts am Limit arbeitet, bedeutet das: weniger Spielraum, weniger Investitionen, mehr Sparkurs.
Viele Kliniken fragen sich bereits, wie sie mit steigenden Energie-, Personal- und Medikamentenkosten umgehen sollen, wenn die Einnahmen gedeckelt werden.
Ökonomen warnen vor einem Dominoeffekt: Sparen die Kliniken bei Personal oder Leistungen, landet der Druck am Ende bei Patienten und Pflegekräften.
Krankenkassen müssen ebenfalls sparen – auch an sich selbst
Der zweite Kostentreiber: die Krankenkassen. Sie müssen 100 Millionen Euro Verwaltungsaufwand streichen. Porto, Werbung, Marketing – all das soll eingedampft werden.
Außerdem halbiert die Regierung die Einzahlung der Kassen in einen Forschungsfonds. Noch einmal 100 Millionen Euro sollen dadurch frei werden.
Politisch klingt das pragmatisch. Faktisch ist es ein Eingriff in die Selbstverwaltung der Kassen – und ein Warnsignal: Der Gesetzgeber greift nicht mehr nur an Symptomen an, sondern am Fundament.
Opposition: „Etikettenschwindel“
Was die Regierung als Durchbruch feiert, nennt die Opposition Augenwischerei.
Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen spricht von einem „Etikettenschwindel“.
Die Linke nennt das Versprechen stabiler Beiträge „wertlos“.
Der Grund: Die Zusatzbeiträge legt nicht der Bundestag fest. Sie werden von den Kassen selbst beschlossen – je nach finanzieller Lage. Und die Prognose der Expertenkommission liegt bereits heute bei 2,9 Prozent, dem aktuellen Niveau. Muss eine Kasse ihre Rücklagen auffüllen, kann sie trotzdem erhöhen.
Mit anderen Worten: Die Ampel begrenzt Kosten, aber nicht die Beitragshöhe.
Pflegekräfte sollen mehr dürfen – Arztmonopol wird aufgebrochen
Parallel zum Sparpaket hat der Bundestag ein zweites, fast revolutionäres Gesetz beschlossen: Pflegekräfte erhalten neue Befugnisse.
Sie sollen künftig Leistungen erbringen dürfen, die bisher ausschließlich Ärztinnen und Ärzten vorbehalten waren. Dazu gehören:
- Versorgung von chronischen Wunden
- Diabetesversorgung
- Betreuung von Demenzpatienten
Pflegekräfte dürfen künftig selbstständig Behandlungen auslösen, wenn sie den Bedarf fachlich feststellen. Welche Leistungen das umfasst, wird in der Selbstverwaltung definiert.
Die Botschaft der Ministerin ist klar:
„Jede Minute, die Pflegekräfte nicht mit Bürokratie verbringen, ist eine Minute für den Menschen.“
Der Schritt ist überfällig – und ein Paradigmenwechsel. Aber er löst das Finanzproblem nicht.
Was bleibt?
Das Sparpaket schützt Versicherte kurzfristig vor höheren Beiträgen – auf dem Papier. Die strukturelle Schieflage des Gesundheitssystems löst es nicht. Kliniken werden zum Sparen gezwungen, Krankenkassen ebenfalls, und die Pflege erhält neue Aufgaben ohne klares Finanzkonzept.