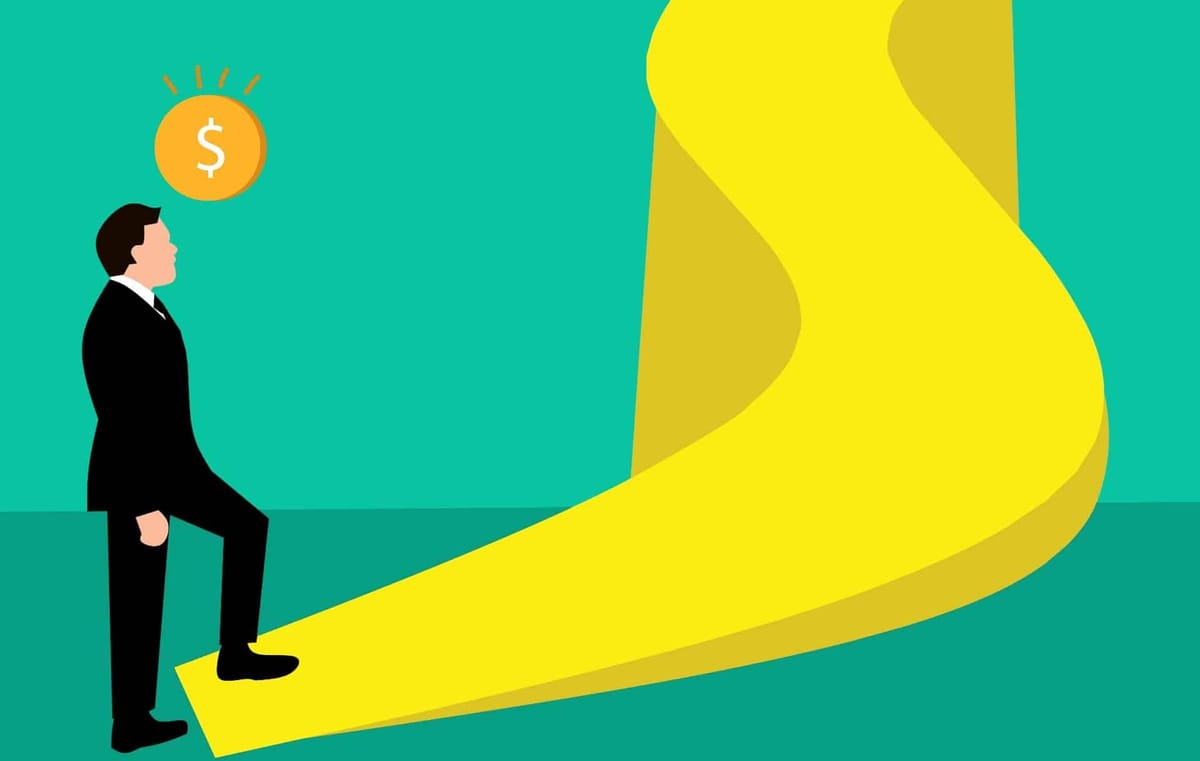Kaum hatte der alte Bundestag seine letzten Beschlüsse gefasst, da floss das Geld schon in Strömen: Sondervermögen hier, neue Kreditermächtigungen da – Schuldenbremse hin oder her.
Infrastruktur und Bundeswehr sollten endlich auf Vordermann gebracht werden. Doch ein aktueller Bericht des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) legt nahe: Der Subventionsrausch könnte am Ende mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.
Subventionen auf Rekordniveau – doch wofür?
127,3 Milliarden Euro an Subventionen zählt das IfW für 2024 – fast dreimal so viel wie noch 2019, vor Corona und Ukrainekrieg. Wohlgemerkt: Steuervergünstigungen sind dabei noch nicht eingerechnet.
Besonders bitter: Nur 12,3 Prozent der Finanzhilfen flossen überhaupt in den dringend benötigten Ausbau von Infrastruktur.
Der Löwenanteil – über 100 Milliarden Euro – wanderte in Projekte rund um Klima und Transformation. Forschung? Gerade einmal 7,6 Prozent der Mittel.
Marktmanipulation mit Ansage
Dass Subventionen sinnvoll sein können, bestreitet niemand. Aber wenn Fördergelder dazu genutzt werden, um unmarktfähige Projekte am Leben zu halten, hebeln sie zwangsläufig die Prinzipien einer funktionierenden Volkswirtschaft aus.
Der Fall „grüner Wasserstoff“ zeigt das Dilemma in Reinform: Um H₂ konkurrenzfähig zu machen, müssen bis zu 90 Prozent der tatsächlichen Produktionskosten durch Steuergeld gedeckt werden. Statt marktwirtschaftlicher Innovation regiert der Subventionsmotor.

Wenn Preise nichts mehr bedeuten
Was früher als Planwirtschaft belächelt wurde, erlebt heute ein grünes Comeback. Nur dass diesmal nicht staatliche Komitees, sondern Preissignale künstlich verzerrt werden, um gewünschte politische Ergebnisse zu erzwingen.
Produziert wird längst nicht mehr das, was effizient und gefragt ist – sondern das, was politisch gewünscht wird. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren: ein fatales Rezept für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit.
Klimaschutz zum Luxuspreis
Wie teuer Deutschlands Subventionspolitik wirklich ist, zeigt der Blick auf den Umweltbonus für E-Autos: Jede eingesparte Tonne CO₂ kostete den Staat rund 1000 Euro – während im EU-Emissionshandel Zertifikate zu 60 bis 100 Euro gehandelt werden.
Anders gesagt: Deutschlands Ansatz war 90 Prozent teurer als notwendig. Und während Länder wie China oder Indien keine Anstalten machen, ihre Emissionen substanziell zu senken, verpuffen deutsche Milliarden im globalen Maßstab wirkungslos.
Subventionskontrolle? Fehlanzeige
Dass das Geld meist ohne klare Erfolgskontrolle verteilt wird, kritisiert auch der Bundesrechnungshof. Oft ist weder transparent, wofür Mittel genau ausgegeben werden, noch werden Programme sinnvoll evaluiert.
Besonders grotesk: Laut einer Studie des Ökonomen Plötz übersteigen klimaschädliche Subventionen in Deutschland mittlerweile die klimafreundlichen Förderungen – und das deutlich.
Mehr Geld – schlechtere Ergebnisse
Besonders bitter wird das Missmanagement am Beispiel Deutsche Bahn sichtbar: Trotz Milliardenhilfen steigen die Schulden auf über 34 Milliarden Euro – während die Pünktlichkeit sinkt und Bauprojekte wie Stuttgart 21 aus dem Ruder laufen.
Was fehlt, sind klare Strukturen, Wettbewerb und Effizienz. Stattdessen wird mit immer neuen Finanzspritzen ein marodes System konserviert.
Wenn Kredite Politikversagen kaschieren sollen
Wer glaubt, mehr Geld löse automatisch mehr Probleme, irrt gewaltig. Ein Blick nach Nordrhein-Westfalen genügt: Dort wurden 2023 gerade einmal 0,38 Prozent der Steuereinnahmen in den Straßenerhalt investiert.
Der politische Wille zählt – nicht die Höhe der Mittel. Kredite können politisches Missmanagement nicht kompensieren. Sie verschieben nur die Rechnung auf spätere Generationen.
Das könnte Sie auch interessieren: