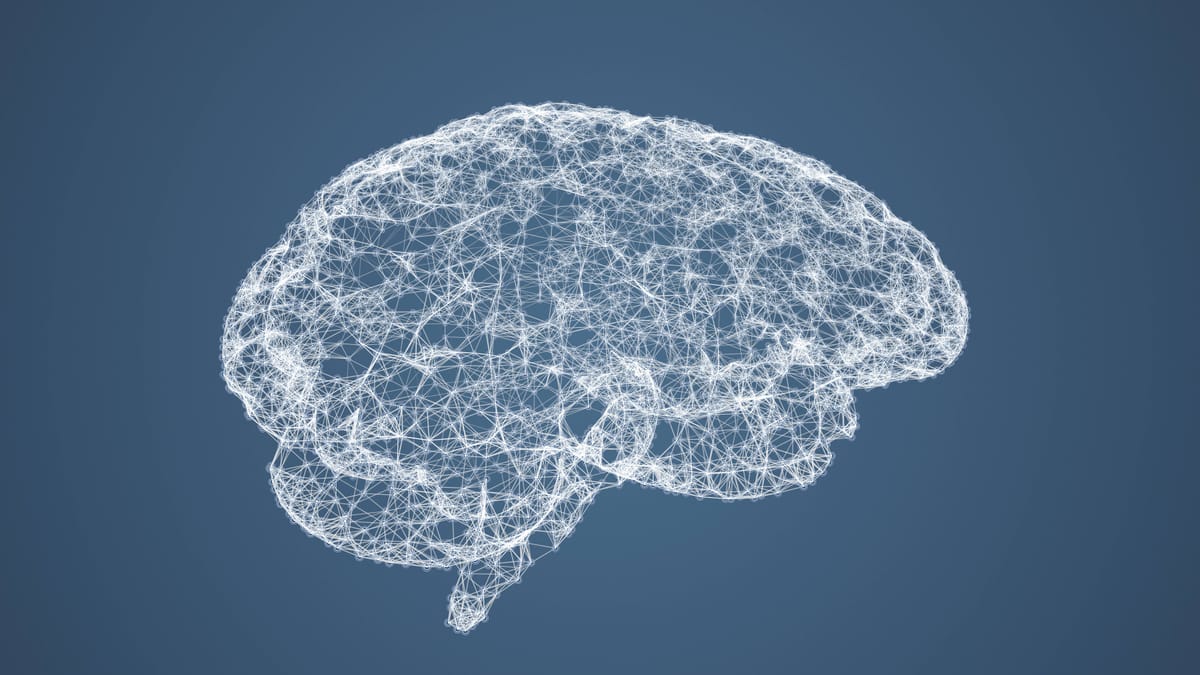Silicon Valley träumt vom Turbo-BIP
Die Idee ist so radikal wie simpel: Wenn Künstliche Intelligenz bald klüger ist als der Mensch – was passiert dann mit der Wirtschaft? In Kalifornien spricht man längst nicht mehr von disruptiven Start-ups oder neuen Apps.
Sondern von einer potenziellen Explosion des globalen Wachstums. Jährliche Zuwächse von 20 oder gar 30 Prozent stehen im Raum.
Das klingt überzogen – aber der Gedanke hat historische Wucht. Denn auch vor der Dampfmaschine glaubte niemand an kontinuierliches Wachstum. Erst Technik brachte den Durchbruch. Nun steht die nächste Technologie parat, die nicht nur Arbeit ersetzt, sondern auch Ideen generieren kann.
Was, wenn Maschinen Innovation liefern?
Bislang galt: Fortschritt ist menschlich. Forschung, Entwicklung, neue Technologien – all das brauchte Menschen mit Fachwissen, Zeit und Glück. Doch mit der sogenannten AGI – also einer allgemeinen, menschenähnlichen KI – könnte sich das ändern.
Systeme wie DeepSeek oder GPT entwickeln sich schneller als gedacht. Und die Vorstellung, dass sie bald auch Forschung betreiben, Medikamente entwickeln oder neue Energiesysteme entwerfen, ist längst nicht mehr Science-Fiction.
Einige Ökonomen rechnen bereits. Wenn eine solche KI etwa ein Drittel aller Tätigkeiten übernehmen kann, steigt das globale BIP laut Modellrechnungen sprunghaft. Die Investitionen in Rechenzentren, Infrastruktur, Energieversorgung müssten dann vervielfacht werden – und Kapital würde zum neuen Engpass.

Wem gehört der Boom?
Eine der zentralen Fragen ist: Wer profitiert? Denn in einer Welt, in der Arbeit durch Maschinen ersetzt wird, verschieben sich Macht und Einkommen. Wenn KIs günstiger und besser arbeiten als Menschen, dann wird Arbeit zur Nebensache. Übrig bleibt: Kapitalbesitz.
Ökonomen wie William Nordhaus zeigen: In einer hochautomatisierten Ökonomie fließen die Erträge fast vollständig an jene, die Eigentum an den Produktionsmitteln – sprich: der KI – haben.
Wer also in Aktien, Serverfarmen oder Software investiert hat, profitiert. Wer nur seine Arbeitskraft anbietet, geht leer aus.
Nicht jeder wird ersetzbar sein
Doch die Sache ist nicht ganz so eindeutig. Es wird auch in Zukunft Bereiche geben, die schwer automatisierbar sind: Handwerk, Pflege, Gastronomie. Hier könnte sogar das Gegenteil passieren – steigende Löhne trotz stagnierender Produktivität.
Ein Effekt, den Wirtschaftswissenschaftler „Baumol-Krankheit“ nennen: Wenn reiche Menschen ihr Geld für Dienstleistungen ausgeben, steigen dort die Löhne mit – obwohl keine Effizienzgewinne erzielt werden.
Das bedeutet: Wer heute kein Tech-Superstar wird, könnte morgen gut damit verdienen, Superstars zu bedienen.
Was macht der Kapitalmarkt daraus?
Kurioserweise preist der Markt die Wachstumsexplosion bislang nicht ein. Zwar sind Tech-Aktien hoch bewertet, aber Anleiherenditen sinken rund um KI-Ankündigungen eher, als dass sie steigen.
Das passt nicht zu einem Szenario, in dem Investitionen explodieren und Zinsen kräftig anziehen.
Denn eigentlich müsste genau das passieren: Steigt das Wachstum stark, steigen auch die Realzinsen – weil Menschen dann lieber heute konsumieren und zum Sparen mit höheren Zinsen gelockt werden müssen. Das wiederum drückt theoretisch die Bewertungen von Aktien. Ein Dilemma.
Wer sich jetzt vorbereitet, liegt vorn
Was also tun? Kapital besitzen – das scheint der einfachste Ratschlag. Doch welche Anlageform? Aktien? Nur, wenn die Zinsen nicht zu stark steigen. Immobilien? Schwierig, wenn Hypotheken plötzlich 30 Prozent kosten. Bargeld? Sicher vor Kursverlusten – aber gefährdet durch Inflation.
Vielleicht liegt die Antwort darin, breit zu streuen – und sich geistig auf eine Welt vorzubereiten, die anders funktionieren wird. In der Eigentum wichtiger wird als Arbeit. Und in der Wissen, Daten und Energie zu den begehrtesten Rohstoffen zählen.
Das könnte Sie auch interessieren: