Der Einstieg in Deutschlands neue Ära der Industriepolitik beginnt mit einer Zahl: 3,1 Milliarden Euro. So hoch schätzt das Bundeswirtschaftsministerium die Kosten des geplanten Industrie-Strompreises – ein Instrument, das aus Sicht der Regierung gleich zwei Probleme lösen soll: die Standortschwäche energieintensiver Branchen und den Investitionsstau in der grünen Transformation. Doch das interne Eckpunktepapier, das Politico vorliegt, zeichnet ein Bild, das weit über eine einfache Preisstütze hinausgeht. Es ist der Versuch, Ordnungspolitik und Subvention zugleich zu sein – und droht dabei, beides nur halb zu erfüllen.
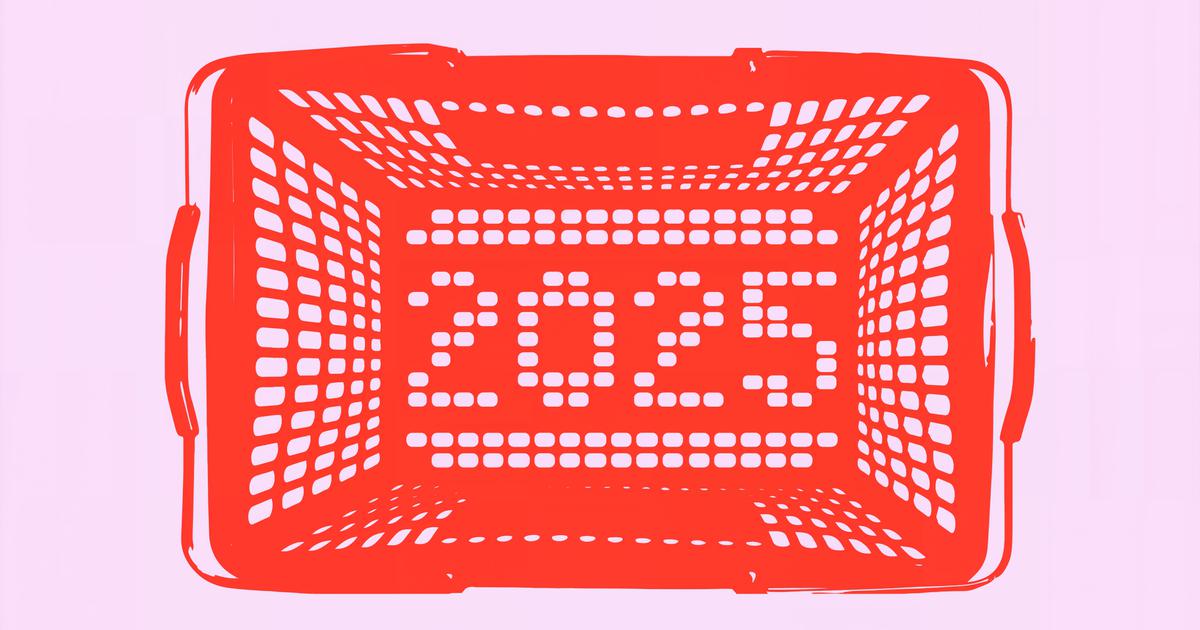
Ein Instrument, das sich erst erklären muss
Die geplante Strompreisbremse sieht vor, dass Unternehmen ab 2027 einen Teil ihrer Energiekosten rückwirkend für 2026 erstattet bekommen können. Der Mechanismus ist technisch, aber entscheidend: Die Betriebe dürfen die Hälfte ihres Stromverbrauchs kompensieren lassen – und zwar die Differenz zwischen Marktpreis und einem festgelegten Referenzwert von fünf Cent je Kilowattstunde.
Die maximale Entlastung fällt bewusst auf das erste Jahr: 1,5 Milliarden Euro. Danach sollen je 800 Millionen Euro folgen. Das Ziel ist klar formuliert: Investitionen sollen „möglichst schnell angereizt“ werden. Dass die Subvention erst rückwirkend kommt, ist kein Fehler, sondern Kalkül. Die Bundesregierung versucht Dynamik zu erzeugen, ohne den Haushalt sofort zusätzlich zu belasten.
91 Branchen – und ein breiter industriepolitischer Anspruch
Die Liste der begünstigten Sektoren ist ein industriepolitisches Panorama: Chemie, Stahl, Zement, Glas, Keramik, Maschinenbau, Papier, Rohstoffe – dazu Batterie- und Halbleiterfertigung. Insgesamt 91 Branchen und Teilsektoren sollen profitieren. Gerade ihnen attestiert die Regierung eine systemische Bedeutung für Wertschöpfung, Exportkraft und Arbeitsplätze.
Diese Breite ist politisch gewollt, ökonomisch aber ambivalent. Je größer der Kreis der Begünstigten, desto schwerer lässt sich die Maßnahme als zielgerichtete Standortpolitik verteidigen. Und umso geringer wird der Anreiz für strukturelle Modernisierung, wenn jede Branche sich als unverzichtbar versteht.

Geld gegen Gegenleistung – theoretisch sauber, praktisch herausfordernd
Um die europäische Beihilfekontrolle zu passieren, verlangt das Ministerium harte Gegenleistungen: Mindestens die Hälfte der Subvention muss in Anlagen fließen, die das Stromsystem entlasten – etwa Erneuerbare, Speicher oder Effizienzprojekte. Unternehmen sollen 48 Monate Zeit haben, die Investitionen umzusetzen, und die Bedingungen sollen „technologieoffen“ ausgestaltet sein.
In der Theorie klingt das nach einem Modell, das ökonomische Effizienz und klimapolitische Vernunft miteinander vereint. In der Praxis droht jedoch ausgerechnet der Kernmechanismus zum Problem zu werden: Die Definition „messbarer Beiträge“ ist technisch komplex, stark regulatorisch – und öffnet ein breites Feld für Interpretationen. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob investiert wird, sondern ob die richtigen Investitionen entstehen.
Degressive Förderung: politisch clever, wirtschaftlich riskant
Unternehmen können zu Beginn der Laufzeit deutlich mehr als 50 Prozent der zustehenden Förderung abrufen. Das beschleunigt zwar Investitionen, verlagert aber ebenso Risiken in die Zukunft. Der Staat trägt faktisch das Anfangsrisiko, während die Firmen später weniger abhängig sind. Die Regierung setzt darauf, dass früh eingesetztes Kapital langfristig kostensenkende Effekte erzeugt.
Doch dieser Optimismus steht im Gegensatz zum Investitionsverhalten vieler energieintensiver Unternehmen, die in den vergangenen Jahren vor allem eines gezeigt haben: Zurückhaltung.
Überlagerung bestehender Instrumente
Parallel existiert bereits die sogenannte Strompreiskompensation, die energieintensive Exporteure seit Jahren entlastet. Beide Instrumente dürfen nicht kumuliert werden, aber die Regierung will die Kompensation ausweiten. Unternehmen sollen ein Wahlrecht haben.
Für die Industrie ist das attraktiv, für den Staat teuer – und für die Regulierung ein Balanceakt. Gleichzeitig verschärft die parallele Existenz zweier Förderlogiken das Grundproblem weiterer Ausnahmen und Sonderpfade im deutschen Energiesystem.
Ein industriepolitischer Spagat
Deutschland versucht, einen industriellen Kern über die energiepolitische Bruchkante zu retten. Die Subvention ist ordnungspolitisch eigentlich ein Fremdkörper – und politisch dennoch kaum vermeidbar. Das Land muss verhindern, dass wichtige Branchen Investitionen ins Ausland verlagern, während gleichzeitig der Transformationsdruck steigt.
Doch am Ende stellt sich die Frage, ob ein auf mehrere Jahre gestrecktes, milliardenteures Subventionsinstrument genügt, um strukturelle Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Oder ob es lediglich Zeit kauft, ohne die zentralen Herausforderungen – hohe Abgaben, langsame Genehmigungen, unklare Netzkosten – zu lösen.
Deutschland gibt der Industrie nun einen Preis. Entscheidend wird sein, ob die Industrie dem Land dafür eine Zukunft baut.




