Die Verhandlung beginnt ohne Anlauf, ohne diplomatische Vorrede – und ohne Zweifel daran, worum es geht: ein Machtkampf um die Grundregeln digitaler Märkte. Vor dem Landgericht Berlin trägt Idealo seine Forderung vor, die inzwischen auf 3,3 Milliarden Euro angeschwollen ist. Der Vorwurf: Google habe seine dominante Suchmaschine systematisch genutzt, um den hauseigenen Dienst Google Shopping zu bevorzugen – und Konkurrenten wie Idealo um Sichtbarkeit, Reichweite und Einnahmen gebracht.

Ein Streitfall mit Vorgeschichte
Die Wettbewerbshüter in Brüssel hatten bereits 2017 festgestellt, dass Google mit dem eigenen Preisvergleichsdienst gegen EU-Kartellrecht verstieß. 2,4 Milliarden Euro Bußgeld folgten – ein Rekord, den der Europäische Gerichtshof erst 2024 bestätigte. Damit steht die Grundfrage nicht mehr zur Debatte: Die EU-Kommission sah eine glasklare Benachteiligung der Konkurrenz.
Was heute verhandelt wird, ist der Schaden. Und der ist aus Idealos Sicht gigantisch. Aus ursprünglich 500 Millionen Euro Schadensersatz sind nach neuer Kalkulation 2,7 Milliarden Euro plus 600 Millionen Euro Zinsen geworden – für den Zeitraum von 2008 bis 2023. Idealo-Mitgründer Albrecht von Sonntag spricht von einer „verlorenen Dekade“, in der Google sich einen Vorsprung erschlichen habe, der weit über klassisches Wettbewerbsverhalten hinausgehe.
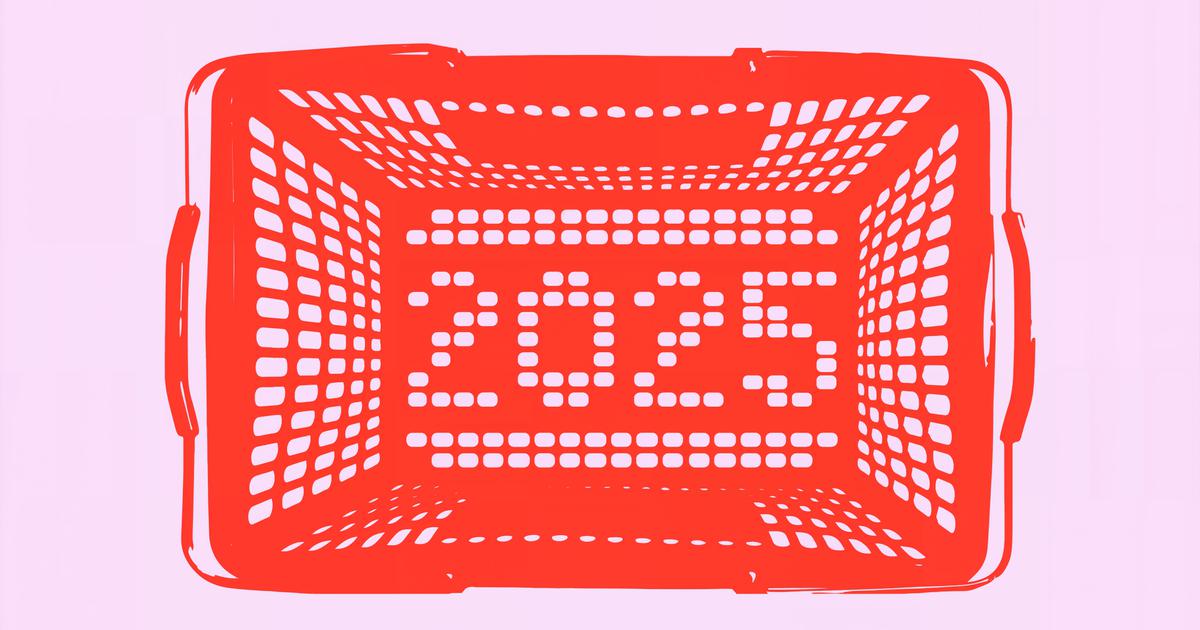
Google verteidigt sich – und verweist auf Reformen
Das Unternehmen hält die Forderung für maßlos. Ja, man habe Fehler gemacht, räumt der Konzern indirekt ein – aber nur in der Vergangenheit. Nach dem Beschluss von 2017 habe Google den Shopping-Bereich geöffnet. Statt exklusiver Eigenplatzierung dürfen seither auch andere Preisvergleichsseiten auf die prominenteste Shopping-Fläche der Suchmaschine zugreifen. Und Google liefert Zahlen, die das belegen sollen: 1550 externe Vergleichsplattformen nutzten inzwischen das geöffnete System, zuvor waren es gerade einmal sieben.
Für Google ist dieser Wandel Beweis genug, dass die kritisierten Strukturen beseitigt sind. Für die EU-Kommission ebenfalls – Brüssel sah zuletzt keinen weiteren Handlungsbedarf. Die Botschaft aus Mountain View: Der Markt ist offen, die Vergangenheit aufgearbeitet, weitere Milliardenforderungen überzogen.
Idealo widerspricht – und sieht ein strukturelles Problem
Auf Idealos Seite klingt es völlig anders. Dort glaubt man nicht an einen Kurswechsel, sondern an geschicktes Feintuning. Kosmetische Änderungen, nicht mehr. Zwar habe Google formal geöffnet, doch die tatsächliche Funktionsweise des Algorithmus, die Reihenfolge der Platzierungen und die kommerziellen Anreize blieben weitgehend identisch. Die Konkurrenz stehe weiterhin dort, wo sie auch vor 2017 schon stand: unten.
„Das Grundproblem der rechtswidrigen Kartellvorteile besteht bis heute“, sagt Mitgründer von Sonntag. Und diese Aussage zielt auf ein Thema, das weit über den konkreten Fall hinausreicht: die Frage, ob sich Plattformdominanz überhaupt regulieren lässt, solange die Regeln und Mechanismen einer Plattform ausschließlich vom Marktführer selbst definiert werden.
Warum der Fall weit über Idealo hinausreicht
Die Klage ist nicht nur ein juristischer Schlagabtausch, sondern ein Test für den Digitalmarkt Europas. Preisvergleichsdienste leben von Sichtbarkeit – und Sichtbarkeit wird im Internet von Suchmaschinen verteilt. Wenn ein Anbieter gleichzeitig Richter und Mitspieler ist, verschieben sich ganze Märkte.
Für Verbraucher geht es – wie Idealo betont – um Transparenz. Für Händler um faire Chancen. Für Europa um die Frage, ob die großen Plattformen tatsächlich kontrolliert werden können oder ob sie de facto über ihre eigenen Wettbewerbsbedingungen bestimmen.
Ein Urteil mit Signalwirkung
Das Landgericht Berlin entscheidet nicht über europäische Wettbewerbspolitik, aber es setzt ein Signal: Lässt sich ein kartellrechtlich bestätigter Missbrauch finanziell beziffern? Und falls ja – wie hoch darf der Preis sein?
Beide Seiten wissen, dass das Verfahren am Ende die Blaupause für weitere Klagen sein könnte. Nicht nur in Europa, auch in den USA, wo ähnliche Vorwürfe gegen Google im Raum stehen.
Der Streit zwischen Idealo und Google ist damit mehr als ein Konflikt zweier Unternehmen. Er ist ein Gradmesser dafür, wie ernst Europa es meint mit seiner Vision fairer digitaler Märkte. Einer dieser Fälle, die aus dem Gerichtssaal hinauswirken – und den Rahmen dessen verschieben, was Big Tech darf und was nicht.




