Google dreht den Hebel um – und zwar sofort. Was in den USA seit 2024 als größter Umbau der Google-Suche seit zwei Jahrzehnten läuft, kommt nun voll nach Europa: Über den Suchergebnissen stehen KI-Überblicke, und mit dem neuen „AI Mode“ wird die Suchmaske zur Arbeitsfläche.
Nutzer fragen in natürlicher Sprache, haken nach, lassen Tabellen skizzieren, Texte kürzen. Nicht mehr die offene Struktur des Webs kuratiert die Antworten, sondern Googles eigene Architektur.

Vom Navigator zum Architekten
Damit verabschiedet sich die Suchmaschine ein Stück weit von ihrer Gründungslogik. Aus dem Verzeichnis, das auf Fundstellen führt, wird eine Antwortmaschine, die Ergebnisse bündelt, neu arrangiert und kommentiert. Wer den KI-Reiter wählt, interagiert mit einem System, das Inhalte aus Quellen zieht – und Nutzer möglichst im Google-Universum hält.
Komfort mit Kollateralschäden
Für viele Anwender ist das ein Segen: komplexe Fragen, eine bündige Antwort. Doch die Bequemlichkeit hat einen Preis – für alle, die Reichweite brauchen. Wo AI-Überblicke prominent erscheinen, fallen die Klicks auf externe Seiten spürbar. Medienhäuser, Vergleichsportale, Bildungsanbieter verlieren Sichtbarkeit, wenn Google die Antworten selbst liefert.
Die Frage ist nicht mehr, wer oben steht, sondern ob überhaupt noch jemand von außen sichtbar wird.
Werbung: teurer, dichter, KI-gesteuert
Googles Geschäftsmodell wird parallel neu verdrahtet. Anzeigen rücken direkt über und unter die KI-Antwortblöcke – weniger Plätze, höhere Preise, mehr Kontrolle. Mit „AI Max“ sollen Werbetreibende die Platzierung gleich der Google-KI überlassen und nur noch fürs Ergebnis zahlen. Vorteil: Reichweiten werden präziser, Produktsuchen kontextreicher. Risiko: Abhängigkeit und Intransparenz steigen, während Alternativen schrumpfen.
Die Kosten der Antwort
Generative Suche ist rechenhungrig. Mehr Rechenzentren, Spezialchips, Energie – die Investitionen drücken zunächst auf die Margen. Google kontert mit Effizienz-Narrativen und skaliert die Werbeerlöse um die neuen Formate herum. Ökonomisch ist das eine Wette auf Zeit: dass die KI-Suche mittelfristig mehr Umsatz pro Anfrage bringt, als sie an Infrastruktur kostet.
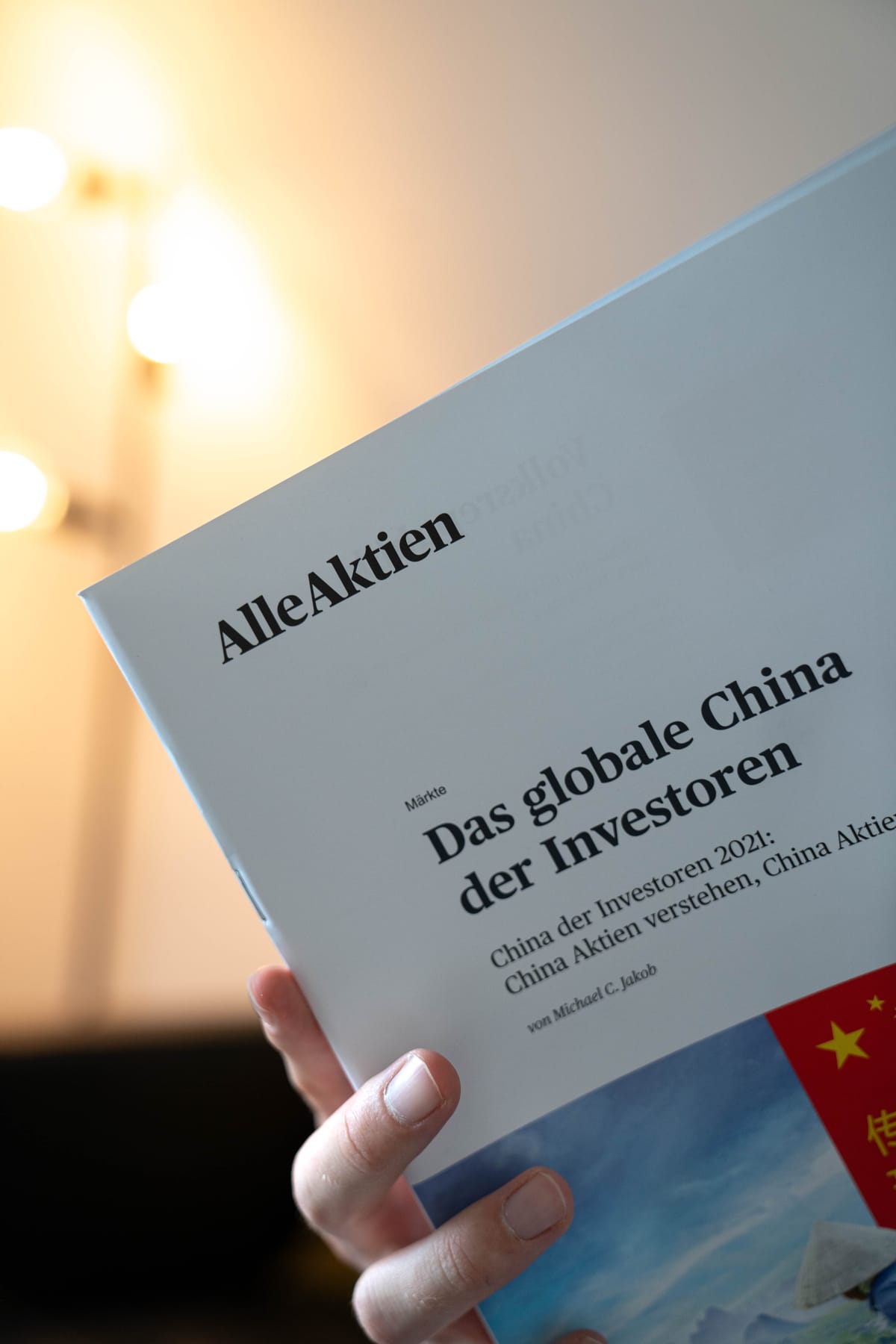
Regulatorik: neue Fragen für alte Gesetze
Mit dem Moduswechsel wächst der regulatorische Druck. Wettbewerbshüter in USA und EU prüfen, ob Google seine Marktmacht verstärkt, indem es Inhalte einzieht, neu ausliefert und Traffic bindet. Für Verlage stellt sich die Vergütungsfrage neu: Wenn KI-Antworten aus Pressebeiträgen schöpfen, wie wird die Leistung abgegolten? Ohne tragfähige Modelle droht ausgerechnet jenes Ökosystem ausgehöhlt zu werden, das die KI zum Antworten braucht.
Strategisches Motiv: Angriff aus der Defensive
Der Umbau ist auch Reaktion: Nutzer weichen bei Wissensfragen zunehmend auf ChatGPT, Perplexity & Co. aus; Microsoft hat KI tief in Bing gedrückt. Google entscheidet sich deshalb für die Flucht nach vorn: Antworten zuerst, Suche danach. Das ist riskant – aber weniger riskant, als das Kerngeschäft von außen kannibalisieren zu lassen.
Was jetzt auf drei Märkten passiert
Medien: Reichweitenmodelle wackeln. Wer bestehen will, muss Inhalte maschinenlesbar, quellenstark und markenunverwechselbar machen – und über Lizenz-/Vergütungsframeworks verhandeln.
Werbung: Performance-Teams werden von Keyword- auf Prompt- und Intent-Logik umstellen. First-Party-Daten und Attributionsklarheit werden zum Engpass.
Wettbewerb: Je stärker Google Antworten kapselt, desto lauter wird der Ruf nach Interoperabilität und Fair-Use-Regeln für Trainings- und Auslieferungsdaten.
Wer kuratiert, trägt Verantwortung
Googles KI-Suche ist bequem, schnell – und mächtig. Mit dem Schritt zum Architekten des Web-Erlebnisses übernimmt der Konzern mehr Verantwortung für Richtigkeit, Vielfalt und Fairness der Antworten. Scheitert dieses Versprechen, verliert nicht nur Google Vertrauen. Dann verliert das Netz seine Offenheit – und damit genau das, woraus die besten Antworten entstehen.



