Europa macht ernst
Die Entscheidung fiel in Florenz, bei einem turnusmäßigen Treffen des EZB-Rats. Ohne auf die Politik zu warten, haben die Währungshüter den Start der nächsten Phase ihres Digitalwährungsprojekts beschlossen. Sollte die EU-Gesetzgebung 2026 verabschiedet werden, will die EZB im Jahr darauf mit einem breiten Pilotversuch beginnen – und 2029 den digitalen Euro ausgeben können.
Die Botschaft ist klar: Europa will nicht länger zuschauen, wie China mit dem digitalen Yuan experimentiert und die USA an einem „digitalen Dollar“ arbeiten. Der Euro soll technologisch aufholen – und zugleich ein Gegengewicht zu privaten Zahlungslösungen wie Visa, Mastercard oder PayPal schaffen.
Was die EZB antreibt
Die Motive sind vielfältig. Zum einen nimmt die Nutzung von Bargeld in Europa seit Jahren ab. Immer mehr Verbraucher zahlen digital, immer seltener mit Münze oder Schein. Ein digitaler Euro soll deshalb kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zum Bargeld werden – eine zusätzliche, sichere Bezahloption, die direkt von der Zentralbank gedeckt ist.
Zum anderen geht es um Souveränität im Zahlungsverkehr. Über 70 Prozent der europäischen Onlinezahlungen laufen derzeit über amerikanische Konzerne. Die EZB sieht darin ein strategisches Risiko: Wer den Zahlungsverkehr kontrolliert, hat Einfluss auf Datenströme und Abhängigkeiten. Der digitale Euro soll Europa unabhängiger machen – politisch, technologisch und ökonomisch.
So sieht der Plan aus
Wenn das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten 2026 den rechtlichen Rahmen beschließen, könnte 2027 die Testphase beginnen. Erste Transaktionen sollen in einem kontrollierten Umfeld mit Banken, Händlern und Verbrauchern laufen. Ziel ist ein stabiles, datenschutzkonformes System, das sowohl online als auch offline funktioniert.
Die Einführung im Jahr 2029 wäre der nächste große Meilenstein der europäischen Geldpolitik seit der Euro-Bargeldeinführung 2002. Die EZB will dabei technische Standards selbst definieren – von der IT-Architektur bis zur Sicherheit. Eine Zusammenarbeit mit Zahlungsdienstleistern ist fest eingeplant, um die Akzeptanz im Alltag sicherzustellen.
Streitpunkt: Grenzen und Kontrolle
So ambitioniert der Plan ist, so umstritten bleibt er. Besonders Banken warnen vor massiven Risiken: Sollte jeder Bürger unbegrenzt digitale Euros halten dürfen, könnten Einlagen von den Konten abfließen – ein potenzielles Risiko für die Stabilität des Finanzsystems.
Die EZB erwägt deshalb eine Obergrenze zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Person. Das würde den digitalen Euro zwar sicherer machen, aber auch weniger attraktiv. Hinzu kommen Kosten: Allein die technische Umsetzung dürfte laut Schätzungen mehr als eine Milliarde Euro verschlingen.
Auch Fragen des Datenschutzes sind ungeklärt. Zwar betont die EZB, der digitale Euro werde „so privat wie möglich“ ausgestaltet, doch viele Bürger befürchten staatliche Einsicht in Zahlungsflüsse.
Widerstand aus der Bankenlobby
Die Kritik der Finanzbranche wird lauter. Banken fürchten nicht nur den Verlust von Kundengeldern, sondern auch steigende Kosten und Konkurrenz zu bestehenden Bezahlmethoden. Sie verlangen klare Grenzen für die Rolle der EZB, damit die Notenbank nicht selbst zum Konkurrenten der Kreditwirtschaft wird.
Auch die Frage, ob Händler Zahlungen mit digitalem Euro verpflichtend akzeptieren müssen, sorgt für Zündstoff. Der bisherige Entwurf sieht eine Annahmepflicht vor – ähnlich wie beim Bargeld. Für viele kleine Betriebe wäre das eine technische und finanzielle Herausforderung.
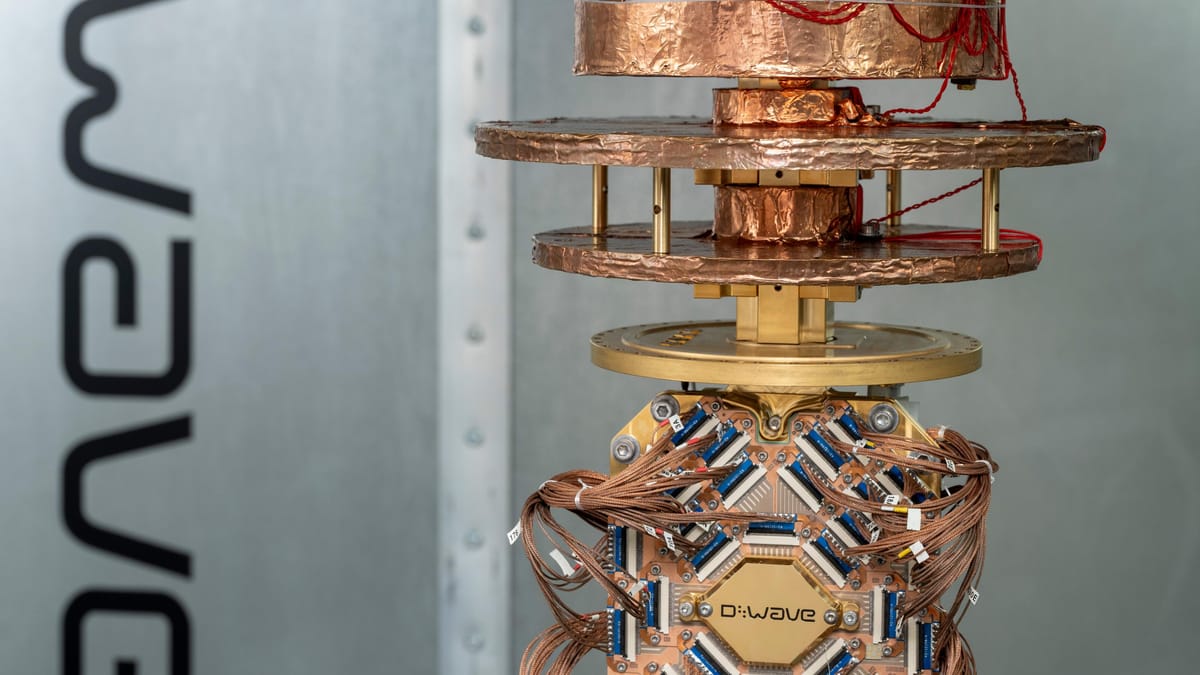
Europas digitale Antwort
Trotz aller offenen Fragen zeigt sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde entschlossen: Europa müsse bei der Digitalisierung des Geldes vorne mitspielen. Der digitale Euro sei „eine Ergänzung, kein Ersatz“ – aber ein notwendiger Schritt, um das Vertrauen in den Euro auch im digitalen Zeitalter zu sichern.
Für die EU ist das Projekt mehr als Geldpolitik. Es ist ein geopolitisches Signal, dass Europa seine technologische und finanzielle Unabhängigkeit ernst nimmt. Während die USA und China längst an staatlich gestützten Digitalwährungen arbeiten, zieht Europa nun nach – mit klarer Struktur, aber ungewisser politischer Rückendeckung.
Der Weg bleibt steinig
Noch ist unklar, ob die politischen Institutionen den ehrgeizigen Zeitplan mittragen. Das EU-Parlament will 2026 abstimmen, anschließend müssen sich Kommission, Rat und Mitgliedsstaaten auf einen finalen Gesetzestext einigen. Erst dann kann die EZB wirklich loslegen.
Doch das Signal ist gesetzt: Der digitale Euro ist kein Zukunftstraum mehr, sondern ein Projekt mit fester Richtung und Zeitplan. Europa will gestalten – und nicht von anderen gestaltet werden.


