Arbeiten? Ja. Aber bitte nicht zu viel
1036 Stunden. So viel arbeitet ein durchschnittlicher Erwerbstätiger in Deutschland pro Jahr – zumindest laut einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).
Nur in Frankreich und Belgien ist der Wert noch niedriger. In Neuseeland hingegen liegt er bei über 1400 Stunden. Das ist ein Unterschied von fast zehn Arbeitswochen.
Natürlich arbeiten wir nicht alle gleich. Die einen buckeln in der Pflege oder auf dem Bau. Die anderen steuern mit Halbtagsvertrag und Remote-Setup durchs Berufsleben. Aber in der Summe steht Deutschland auf dem drittletzten Platz im OECD-Ranking. Und das ist ein Problem.
Mehr Menschen in Arbeit – aber weniger Zeit im Job
Der Grund ist nicht etwa Faulheit, sondern Struktur. Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten viele Menschen in Beschäftigung gebracht, aber oft in Teilzeit oder Minijobs.
Vor allem Frauen arbeiten weiterhin deutlich kürzer – nicht weil sie nicht wollen, sondern weil es oft nicht anders geht: fehlende Kitas, unflexible Arbeitszeiten, hoher Mental Load.
Hinzu kommt der gesellschaftliche Wandel. Begriffe wie Work-Life-Balance, New Work oder Vier-Tage-Woche haben den alten Leistungsbegriff ersetzt. Und das nicht nur in hippen Start-ups, sondern quer durch die Büros der Republik.
Fachkräftemangel trifft auf verkürzte Wochen
Während sich eine Gesellschaft mental auf weniger Arbeit einstellt, fehlen gleichzeitig Millionen Stunden auf dem Arbeitsmarkt. IW-Präsident Michael Hüther bringt es auf den Punkt:
„Restaurants haben häufiger geschlossen, Pflegekräfte sind überlastet, Handwerksbetriebe suchen verzweifelt Personal.“
Bis Ende des Jahrzehnts könnten laut IW bis zu 4,2 Milliarden Arbeitsstunden fehlen. Das ist kein Randproblem – das ist ein Strukturbruch. Denn was nützen gut ausgebildete Menschen, wenn am Ende die Zeit fehlt, in der sie arbeiten?
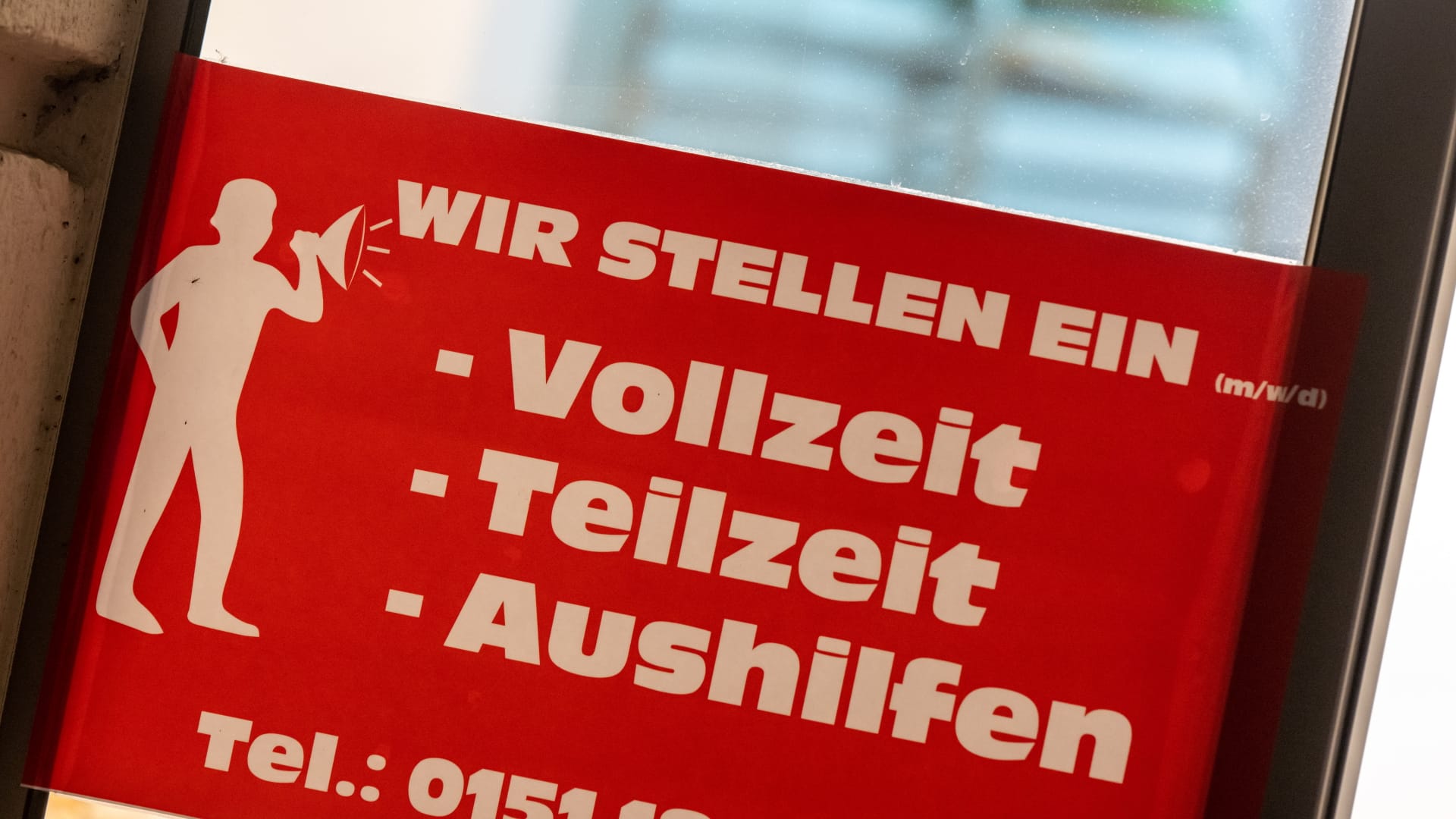
Friedrich Merz und die unbequeme Debatte
CDU-Chef Friedrich Merz hat sich zuletzt in die Diskussion eingemischt – mit dem Satz: „Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance können wir den Wohlstand nicht erhalten.“ Das klang für viele nach Kulturkampf. Doch in der Sache hat er Recht: Wer weniger arbeitet, erwirtschaftet auch weniger. Und der deutsche Sozialstaat ist nicht gerade auf Sparflamme ausgelegt.
Die Babyboomer gehen in Rente, die Pflegekosten steigen, der öffentliche Dienst sucht Nachwuchs – doch die Netto-Arbeitszeit pro Kopf sinkt. Eine gefährliche Gleichung.
Zwischen Lifestyle und Leistungsgrenze
Natürlich ist nicht jede Stunde gleich viel wert. Deutschland hat eine hohe Arbeitsproduktivität, die viele Stunden wettmacht. Aber auch Produktivität hat Grenzen. Und die Erfahrung zeigt: Weniger Arbeitszeit wird selten durch bessere Effizienz kompensiert – erst recht nicht flächendeckend.
Der Trend zur Reduktion hat sich längst verselbständigt. Die Diskussion über Arbeitszeitverkürzung wird oft geführt, als gäbe es keine demografische Entwicklung und keine realen Lücken in Pflege, Bildung oder Handwerk. Das ist bequem – aber naiv.
Was jetzt passieren müsste
Mehr Kinderbetreuung, flexible Vollzeitmodelle, gezielte Zuwanderung, eine bessere Nutzung der inländischen Arbeitskräfte – es gibt viele Stellschrauben. Doch bislang fehlt der politische Wille, konsequent gegenzusteuern. Der Zeitgeist hat sich eingerichtet. Und das macht es so schwer, eine Kurskorrektur überhaupt zu diskutieren.
Das könnte Sie auch interessieren:


