Schon am Eingang des Forschungszentrums in San Sebastián hängt ein Satz, der kaum größer klingen könnte: „Welcome to hope“. Hoffnung – ein großes Wort in einer Branche, die gelernt hat, dass sie selten hält, was sie verspricht. Doch für den deutschen Pharmariesen Bayer ist Hoffnung dieser Tage mehr als ein Gefühl. Sie ist Strategie.
Im Inneren des hell erleuchteten Gebäudes des Tochterunternehmens Viralgen, einer Einheit des US-Biotech-Unternehmens AskBio, arbeitet eine Handvoll Forscher an etwas, das – sollte es gelingen – die Medizin verändern könnte: eine Gentherapie gegen Parkinson. Ihre Werkzeuge sind winzige, harmlose Viren, die als Transportvehikel für Gene dienen sollen. Diese sollen im Gehirn von Patienten das Defizit eines Stoffes beheben, dessen Fehlen das Zittern, Erstarren und Verlangsamen verursacht: Dopamin.
„Seit fünf Jahrzehnten gab es keinen echten Fortschritt bei der Behandlung von Parkinson“, sagt Bayer-CEO Bill Anderson. Und dieser Satz klingt nicht nach Klage, sondern nach Kampfansage.

Ein Wettlauf mit der Biologie
Kaum ein Bereich der Medizin hat in den vergangenen Jahren so viele Versprechen und gleichzeitig so viele Enttäuschungen produziert wie die Zell- und Gentherapie. Sie ist das vielleicht ambitionierteste Projekt moderner Pharmatechnologie: Krankheiten heilen, nicht nur lindern – und das womöglich mit einer einzigen Spritze.
Schon heute lassen sich körpereigene Abwehrzellen genetisch „schärfen“, um Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Andere Ansätze versuchen, bei seltenen Erbkrankheiten fehlerhafte Gene durch intakte Kopien zu ersetzen. Über ein Dutzend solcher Therapien ist in der EU bereits zugelassen, weltweit laufen mehrere Tausend Studien.
Doch die Erfolgsbilanz bleibt durchwachsen. Die Biologie ist komplex, der menschliche Körper kein planbares System. „Das erfordert ein tiefes Verständnis der molekularen Abläufe und ihrer Wechselwirkungen“, erklärt Stefan Oelrich, Bayers Pharmachef. „Das ist nichts, was man einfach hochskaliert wie eine Tablettenproduktion.“
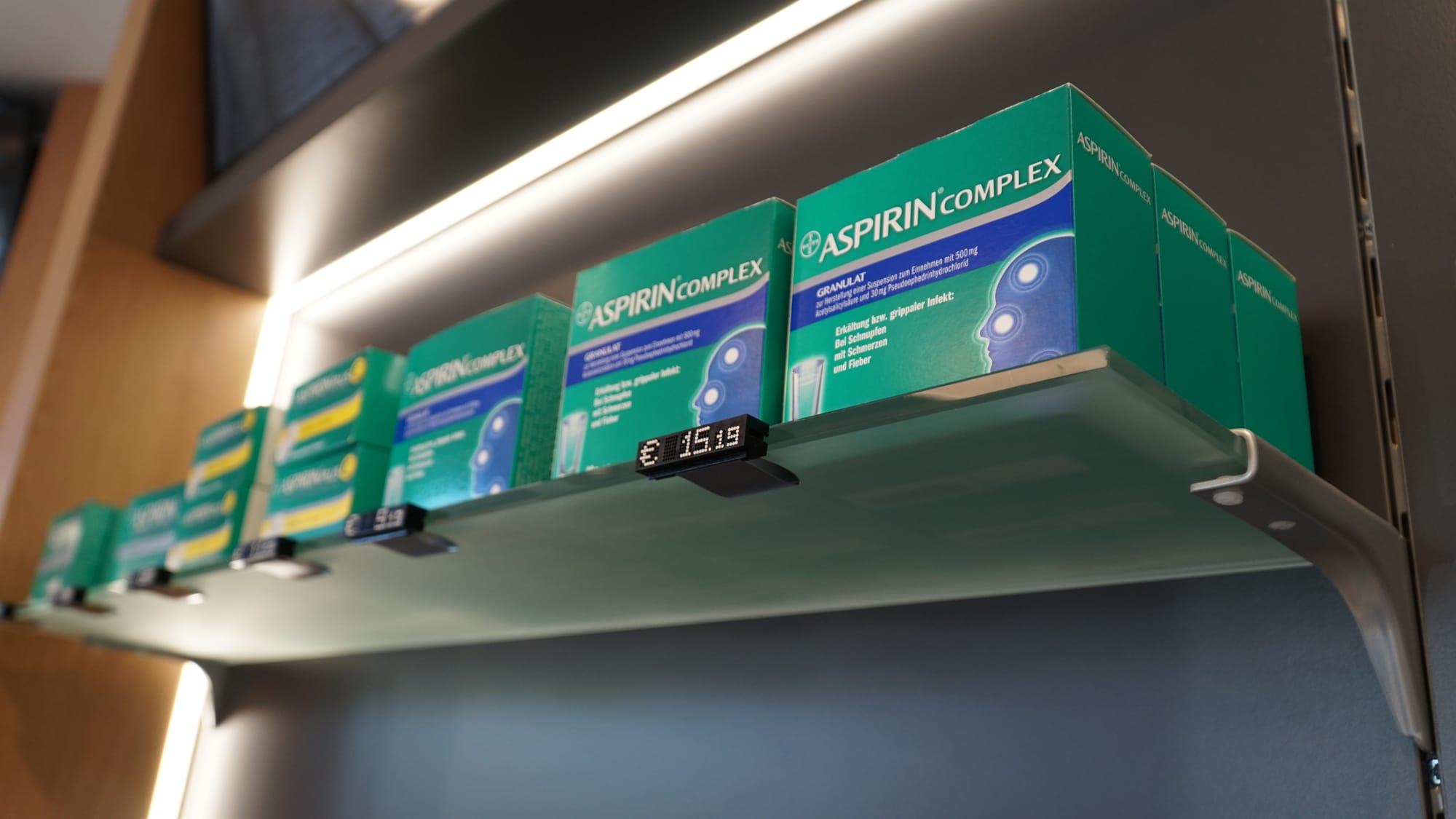
Millionenpreise, Mini-Märkte
Der Traum von der Heilung hat bislang einen Preis, den selbst reiche Gesundheitssysteme kaum tragen können. Zolgensma, die Gentherapie von Novartis gegen spinale Muskelatrophie, kostet rund 1,4 Millionen Euro pro Dosis. Anfangs waren es über zwei Millionen. Krankenkassen zahlen nur nach aufwendigen Prüfungen, Eltern kämpften mit Spendenaktionen um die Behandlung ihrer Kinder.
Viele dieser Therapien blieben wirtschaftlich hinter den Erwartungen zurück. CAR-T-Zelltherapien, einst als Revolution in der Krebsmedizin gefeiert, werden längst von günstigeren Alternativen verdrängt. Selbst Blockbuster wie Kymriah von Novartis schaffen es nicht mehr in die Umsatzcharts.
Die Hoffnung, mit einer Einmalspritze Milliardenerträge zu erzielen, hat sich nicht erfüllt. Die Realität ist komplizierter – biologisch, regulatorisch und ökonomisch.

Bayer setzt auf Geduld und doppelte Strategie
In Bayers Pipeline laufen zwei Projekte parallel: AskBio arbeitet an einer Gentherapie, BlueRock, eine weitere US-Tochter, an einer Zelltherapie, bei der mit einer feinen Nadel gezüchtete Nervenzellen ins Gehirn implantiert werden. Beide Ansätze zielen darauf ab, die Dopaminproduktion wieder anzukurbeln – also die Ursache der Krankheit zu bekämpfen, nicht nur ihre Symptome.
BlueRock hat gerade von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Freigabe für die finale klinische Studie erhalten. Rund 100 Patienten sollen teilnehmen, zwei Drittel davon mit Wirkstoff, der Rest mit Placebo. Erste Ergebnisse werden 2029 erwartet.
Ein Erfolg wäre wissenschaftlich spektakulär – wirtschaftlich aber noch schwer einzuschätzen. Die Kosten pro Behandlung könnten 250.000 Euro erreichen. „Das wäre vor allem für Patienten interessant, bei denen die Standardtherapie versagt“, sagt Markus Manns, Mediziner und Fondsmanager bei Union Investment.
BlueRock-CEO Seth Ettenberg hält sich mit Prognosen zurück: „Unser Ziel ist es, eine neue Therapieoption für Patienten zu schaffen. Alles andere kommt danach.“
Mehr als ein Laborprojekt
Der Konzern sendet mit seinem Engagement ein deutliches Signal: Er glaubt an das Potenzial der Gen- und Zelltherapie – und er investiert, wo andere kürzen. Direkt neben dem Berliner Pharma-Hauptquartier in Wedding entsteht derzeit ein Zentrum für Zell- und Gentherapien. Der Spitzname im Unternehmen: „Boston an der Spree“.
Das Projekt, eine Kooperation von Bayer, dem Bund, dem Land Berlin und der Charité, soll 2028 eröffnen. Start-ups sollen dort Ideen entwickeln, gleich vor Ort klinisches Material produzieren und so schneller den Sprung von der Theorie zur Anwendung schaffen. „Wir wollen, dass Deutschland in diesem Bereich nicht nur forscht, sondern führt“, sagt Oelrich.
Die Vision: Ein Innovationsökosystem, das medizinische Grundlagenforschung mit industrieller Umsetzung verbindet – etwas, das in Europa bisher fehlt.
Wenn Hoffnung konkret wird
Im baskischen San Sebastián trifft sich an einem milden Herbstnachmittag die Spitze von Bayer, AskBio und BlueRock. In einem Konferenzraum im Erdgeschoss des Labors besprechen die Manager ihre Strategie, während zwei Stockwerke darüber Viren kultiviert werden, die einmal Menschenleben verändern könnten.
Dort, zwischen Edelstahlbehältern und Pipettierrobotern, nimmt Hoffnung buchstäblich Form an. Eine Hoffnung, die diesmal vielleicht mehr ist als nur ein Versprechen.
„Allein die Vorstellung, Parkinson umkehren zu können, erzeugt bei mir eine Gänsehaut“, sagt Stefan Oelrich.
Analyse: Ein riskanter Hoffnungsträger
Trotz aller Euphorie bleibt Bayers Vorstoß riskant. Der Konzern bewegt sich auf einem Markt, der wissenschaftlich hochkomplex und wirtschaftlich unsicher ist. Der Bedarf ist enorm – weltweit leiden über zehn Millionen Menschen an Parkinson –, aber die Entwicklungskosten sind gewaltig, die Zulassungsverfahren streng, die Erstattung unklar.
Bayer könnte sich hier in einer seltenen Rolle wiederfinden: als Konzern, der nicht auf schnellen Profit, sondern auf langfristige Wirkung setzt. Sollte das gelingen, wäre es nicht nur ein medizinischer Fortschritt, sondern auch ein kultureller.
Denn was in San Sebastián geschieht, ist nicht weniger als der Versuch, den menschlichen Körper neu zu programmieren – und das Leben selbst zu reparieren.




