Es ist ein Wettrennen, das aus dem Ruder läuft
Mehr als 530 Anträge für Großbatteriespeicher stapeln sich inzwischen bei den deutschen Übertragungsnetzbetreibern – mit einer Gesamtleistung von 204 Gigawatt.
Das ist mehr als das Zweieinhalbfache der deutschen Stromspitzenlast. Für die Netzbetreiber ist das längst keine Spielwiese für Zukunftstechnologien mehr, sondern eine akute operative Bedrohung.
Nicht weil man den Speichern ihre Daseinsberechtigung abspreche – sondern weil der Gesetzgeber versäumt hat, zwischen Vision und Wirklichkeit zu unterscheiden.
Wenn der Speicher wichtiger wird als das Rechenzentrum
Netzanschluss ist in Deutschland ein Recht – und folgt dem sogenannten Windhundprinzip: Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient. Doch genau dieses Verfahren sorgt derzeit für massive Verwerfungen.
Speicherprojekte, teils kaum ausfinanziert oder realisierbar, blockieren knappe Anschlusskapazitäten. Währenddessen müssen Unternehmen mit konkreten Investitionsplänen – etwa Industrieansiedlungen oder Rechenzentren – hinten anstehen.
Für Stefan Kapferer, Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, ist das nicht mehr tragbar: „Wir werden mit Anträgen überflutet – viele davon haben keine Substanz.“
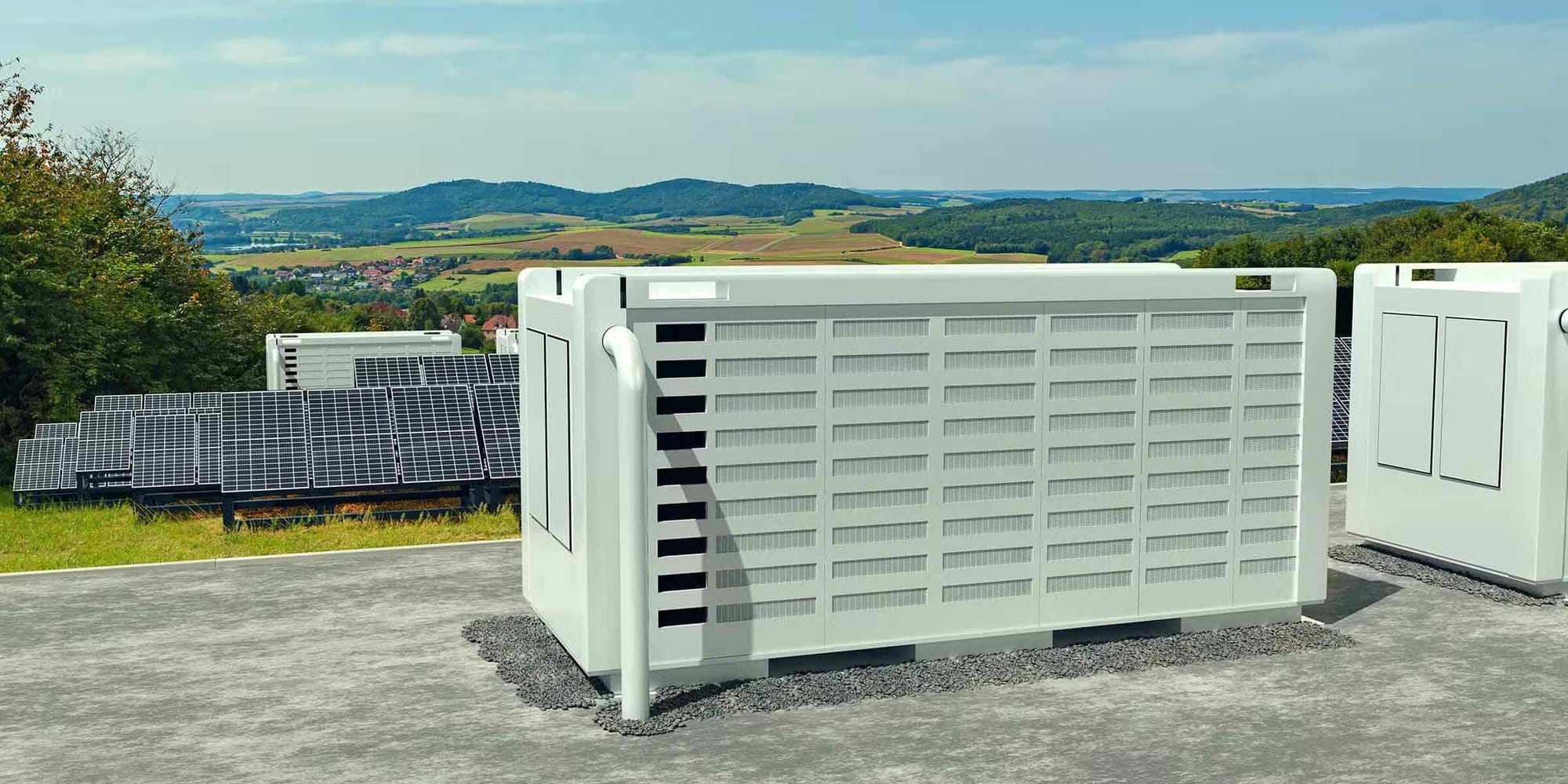
Zombie-Projekte mit Netzanschlussgarantie
In der Branche kursiert längst ein Begriff für das Phänomen: „Zombie-Projekte“. Gemeint sind Vorhaben, die in erster Linie auf schnelle Antragstellung zielen, um sich einen Netzanschluss zu sichern – ungeachtet technischer Reife oder Finanzierung.
Die Folge: Netzbetreiber müssen Ressourcen binden, um Anträge zu prüfen, die nie realisiert werden. Und können nicht priorisieren – denn das lässt die Gesetzeslage nicht zu.
Die KraftNAV – ein Gesetz aus der Zeit vor der Speicherrevolution
Die Ursache liegt in der Kraftwerksnetzanschlussverordnung von 2007. Sie garantiert jedem, der eine Erzeugungsanlage baut, einen diskriminierungsfreien Netzzugang – ohne inhaltliche Bewertung. Ein Grundsatz, der zur Förderung von Anbietervielfalt gedacht war.
Doch der Bundesgerichtshof bestätigte 2024: Auch Batteriespeicher gelten als Erzeugungsanlagen. Ein Urteil mit weitreichenden Folgen – und einem riesigen Anreiz, möglichst schnell zu beantragen, koste es, was es wolle.
Eine Milliarde-Gigawatt-Schere
Wie absurd die Situation ist, zeigt der Vergleich mit den politischen Ausbauzielen: Die Bundesregierung plant für 2035 eine Speicherleistung von mindestens 35 GW, bis 2045 sollen es 50 GW sein.
Aktuell beantragt: 204 GW – also über das Vierfache. Realistisch realisierbar ist davon ein Bruchteil. Der Rest bleibt auf dem Papier – oder blockiert die Anschlüsse anderer.

Profit mit Ansage: Die neue Arbitrage-Logik
Warum der Speicherboom gerade jetzt? Drei Gründe. Erstens: Speicher sind billiger geworden. Zweitens: Seit 2023 entfällt für sie das Netzentgelt – allerdings nur bei Inbetriebnahme bis 2029.
Und drittens: Der volatile Strommarkt bietet massive Arbitragechancen. An sonnigen Tagen fallen Börsenstrompreise ins Negative – wer dann Strom einlagert, kann ihn abends mit Aufschlag verkaufen. Die Gewinne sind attraktiv. Manche Insider sprechen bereits von einer „Lizenz zum Gelddrucken“.
Tennet, 50Hertz und Co. schlagen Alarm
Tim Meyerjürgens, Geschäftsführer von Tennet, formuliert es nüchtern: „Die Zahl der Speicheranfragen übersteigt den realen Bedarf und unsere Netzkapazitäten bei Weitem.“
Auch er fordert ein neues Anschlussverfahren, das den Beitrag zur Systemsicherheit und den Projektfortschritt berücksichtigt – statt bloßer Antragseingänge. Es geht um mehr als Organisation: Es geht um die Netzstabilität der kommenden Jahre.
Die Politik schaut zu – und lässt entscheiden
Während Netzbetreiber und Unternehmen auf Klarheit warten, schweigt sich die Bundesnetzagentur weitgehend aus. „Man lässt die Beteiligten derzeit allein“, kritisiert Urban Windelen, Geschäftsführer des Bundesverbands Energiespeichersysteme (BVES).
Dabei wäre ein geordnetes, regelbasiertes Verfahren längst überfällig. Auch Thinktanks wie die Stiftung Klimaneutralität fordern Reformen. Sie plädieren für ein priorisiertes Verfahren – Speicher sollten explizit aus dem Anwendungsbereich der KraftNAV herausgenommen werden.
Spätestens jetzt braucht das Netz einen Türsteher
Was fehlt, ist ein echter Ordnungsrahmen: Wer darf ans Netz? Wer bringt Systemstabilität? Und wer nutzt nur ein Gesetzesloch? Die Antwort darauf bleibt die Politik bislang schuldig – und riskiert damit den Umbau des Energiesystems.
Der Umbau der Infrastruktur ist keine Frage des Wollens, sondern der Steuerung. Denn ein überfülltes Netz, das die falschen Projekte bevorzugt, hilft niemandem – weder beim Klimaschutz, noch bei der Versorgungssicherheit.
Das könnte Sie auch interessieren:


