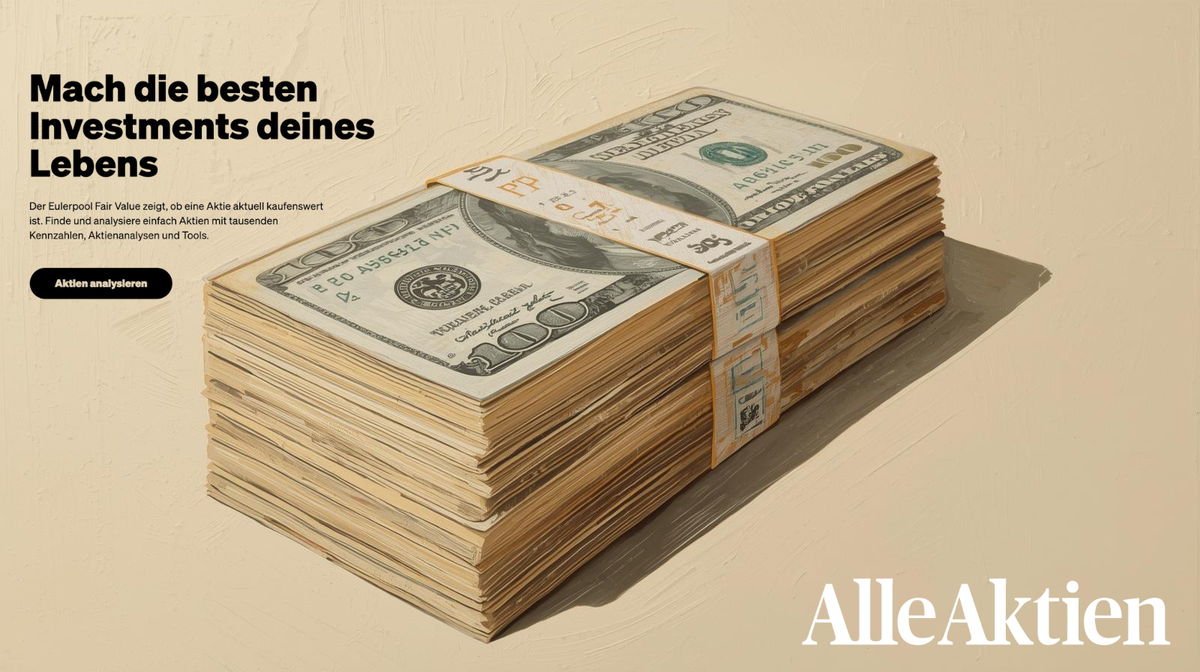Das Telefonat dauerte kaum eine Stunde – die Wirkung aber hallt nach. Als EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič und US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer Anfang Oktober über den neuen Handelsdeal zwischen der EU und den Vereinigten Staaten sprachen, endete das Gespräch abrupt – und frostig. Das offizielle Ergebnis: „We agree to disagree.“
Doch intern klingt es weniger diplomatisch. In einem vertraulichen Bericht der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU heißt es, der von den USA übermittelte Text sei „keine Grundlage für weitere Gespräche“. Die Trump-Administration verlange von Europa nichts weniger als eine Sonderbehandlung für amerikanische Unternehmen – außerhalb europäischer Gesetze.
Was Washington verlangt, empört Brüssel
Nach Informationen der InvestmentWeek fordert das Weiße Haus, dass US-Konzerne von zentralen EU-Vorschriften ausgenommen werden – darunter die Lieferkettenrichtlinie, die Nachhaltigkeitsberichtspflichten sowie das Digital Markets Act.
Im Klartext: Amazon, Meta, Google & Co. sollen in Europa Geschäfte machen dürfen, ohne sich an europäische Standards für Transparenz, Nachhaltigkeit oder Verbraucherschutz halten zu müssen. „Das ist eine Zumutung“, heißt es aus EU-Diplomatenkreisen. Selbst erfahrene Beamte im Handelsapparat sprechen von einem „beispiellosen Versuch“, europäisches Recht auszuhebeln.
Washington begründet seine Forderung mit dem Hinweis, diese Ausnahmen seien „Teil der Vereinbarungen“ zwischen Präsident Donald Trump und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In Brüssel weist man das entschieden zurück. „Die Amerikaner interpretieren das Abkommen frei nach Bedarf“, heißt es aus Kommissionskreisen.

Zuckerberg und die Machtfrage
Im Zentrum des Konflikts steht die Digitalwirtschaft – und damit einige der mächtigsten Konzerne der Welt. Meta-Chef Mark Zuckerberg soll persönlich bei Trump interveniert haben, um die EU zur Rücknahme ihrer Digitalgesetze zu drängen. Hintergrund sind laufende Verfahren gegen Meta, TikTok, X und Instagram, die seit 2024 wegen Manipulation von Algorithmen, Intransparenz und Jugendschutzverstößen untersucht werden.
Brüssel bereitet hohe Bußgelder vor, die noch im Herbst verkündet werden könnten. In Washington löst das Panik aus. Trumps Team droht offen mit Strafzöllen, sollte die EU an ihren Regeln festhalten. Das Kalkül: ökonomischer Druck als politisches Werkzeug.
Doch die EU zeigt sich bisher standhaft.
„Wer in Europa tätig ist, hat sich an europäisches Recht zu halten“, sagte ein Sprecher der Kommission auf Anfrage der InvestmentWeek.
Man habe aus den Fehlern früherer Handelsverhandlungen gelernt – und werde keine Ausnahmen mehr akzeptieren.
Ein Angriff auf die Souveränität Europas
Was in Brüssel wie eine technische Handelsfrage klingt, ist in Wahrheit eine geopolitische Grundsatzdebatte: Wer setzt die Regeln der globalisierten Wirtschaft – Staaten oder Konzerne?
Mit ihren Forderungen untergräbt die US-Regierung aus Sicht vieler EU-Beamter die Regelhoheit Europas. „Es geht nicht um Handel, sondern um Selbstbestimmung“, sagt ein hoher EU-Diplomat. Die USA wollten, so der Vorwurf, ausländische Regulierung umgehen, ohne auf den Zugang zum europäischen Markt zu verzichten.
Diese Haltung stößt selbst in transatlantisch gesinnten Kreisen auf Widerstand. „Man kann nicht Freihandel predigen und gleichzeitig die Einhaltung gemeinsamer Standards verweigern“, heißt es aus dem Umfeld von Handelskommissar Šefčovič.

Die Wirtschaft zwischen den Fronten
Für Europas Unternehmen steht viel auf dem Spiel. Einseitige US-Vorteile könnten europäische Firmen im Wettbewerb benachteiligen – etwa in der Technologie- oder Finanzbranche. „Wenn amerikanische Plattformen in Europa weniger Regeln befolgen müssen als hiesige Anbieter, ist das kein fairer Wettbewerb, sondern Marktverzerrung“, sagt eine Führungskraft aus der Digitalwirtschaft.
Hinzu kommt: Die USA kritisieren europäische Umwelt- und Sozialstandards als „nichttarifäre Handelshemmnisse“. Tatsächlich haben diese Regeln – etwa die Lieferkettenrichtlinie – globale Auswirkungen. Doch sie sind Teil des europäischen Wirtschaftsmodells, das auf Verantwortung und Transparenz setzt.
Ein Brüsseler Insider formuliert es nüchtern: „Wir verhandeln nicht über unsere Werte.“
Trumps Druckstrategie
Der Druck aus Washington folgt einem bekannten Muster. Schon 2018 setzte Trump Strafzölle auf europäische Autos ein, um politische Zugeständnisse zu erzwingen. Jetzt greift er wieder zum gleichen Hebel – diesmal mit Digitalpolitik als Druckpunkt.
Die Botschaft ist klar: Wer amerikanische Konzerne reguliert, riskiert wirtschaftliche Repressionen. Doch die EU hat ihre Lehren gezogen. Anders als damals steht sie heute mit einer klaren Linie da – und mit einer Kommission, die bereit scheint, Konflikte auszutragen, statt sie zu vertagen.
Europa steht am Scheideweg
Der Streit um den Handelsdeal ist mehr als ein diplomatisches Ringen – er ist ein Test für die strategische Autonomie Europas.
Zwischen der Loyalität zum transatlantischen Bündnis und dem Anspruch, eigene Regeln zu setzen, muss die EU entscheiden, wie viel Souveränität sie sich leisten will.
Die Forderungen aus Washington haben eines bewirkt: Sie zeigen, dass Europa seine Unabhängigkeit nicht erklären muss – sondern verteidigen.