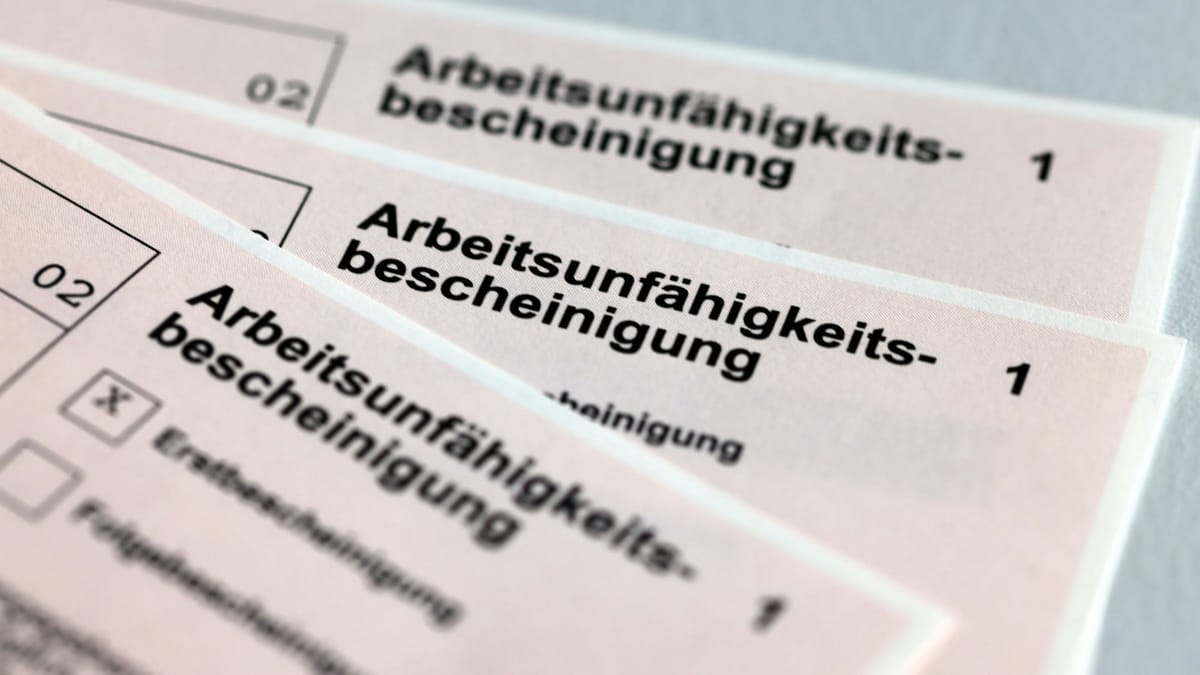Ein Vorstoß, der polarisiert
Clemens Hoch (SPD) hat ein Thema angestoßen, das jeden betrifft, der arbeitet: die Krankschreibung. Während bisher nach drei Tagen ein ärztliches Attest nötig ist, will Hoch die Pflicht verschieben – auf bis zu 14 Tage. Das sei, so der Minister, ein notwendiger Befreiungsschlag für ein überlastetes Gesundheitssystem.
„Wir müssen den Ärzten die Zeit geben, sich auf wirklich Kranke zu konzentrieren, nicht auf Formalien“, sagte er gegenüber der dpa.
Die Idee stößt auf Zustimmung – und auf scharfe Kritik. Ärztevertreter sprechen von einer „mutigen, aber überfälligen“ Reformidee. Arbeitgeber dagegen fürchten Missbrauch und steigende Fehlzeiten.

100 Millionen Euro Entlastung oder Milliardenkosten?
Laut Berechnungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sind rund 35 Prozent aller Krankschreibungen ohnehin kürzer als drei Tage. Diese Fälle verursachen jedoch Millionen von Arztbesuchen, die kaum medizinischen Mehrwert bringen.
Würde man auf Atteste in dieser Zeit verzichten, könnten laut KBV jährlich rund 100 Millionen Euro an Bürokratiekosten eingespart werden.
Ganz anders sehen es Arbeitgeberverbände. Sie warnen, längere Selbstmeldungen ohne Nachweis könnten zu einem „Bürokratieabbau auf dem Papier“ führen – während Unternehmen die Mehrkosten durch Produktivitätsverluste tragen.
Vertrauen statt Kontrolle
Hochs Vorschlag setzt auf ein anderes Prinzip als bisher: Vertrauen. „Die Menschen arbeiten hart und gewissenhaft. Wer krank ist, bleibt zuhause – dafür braucht es nicht immer einen Stempel vom Arzt“, sagte der SPD-Minister.
Er verweist auf skandinavische Länder, in denen Arbeitnehmer sich bis zu sieben Tage selbst krankmelden dürfen – mit positiven Erfahrungen.
Doch Deutschland tickt anders. Hier gilt die Devise: Vertrauen ist gut, Bescheinigung ist besser. Die Furcht vor Blaumacherei sitzt tief, auch wenn Studien zeigen, dass Missbrauchsfälle im Promillebereich liegen.
Ein System unter Druck
Mit durchschnittlich 19,7 Krankheitstagen pro Beschäftigtem im Jahr 2024 liegt Deutschland auf Rekordniveau. Atemwegserkrankungen, psychische Belastungen und Fachkräftemangel verstärken den Druck auf Unternehmen und Krankenkassen gleichermaßen.
Hochs Vorschlag kommt also nicht aus dem luftleeren Raum – er ist eine Reaktion auf ein überfordertes System. Doch Kritiker fragen: Wenn Ärzte Zeit sparen, wer zahlt am Ende die Zeche, wenn Fehlzeiten steigen?
Zwischen Entlastung und Risiko
Dass Hoch mit seinem Vorstoß polarisiert, ist ihm bewusst. Er will die Debatte öffnen, nicht abschließen. Auch KBV-Chef Andreas Gassen, der ursprünglich nur vier Tage vorgeschlagen hatte, spricht von einem „ersten Schritt, Bürokratie mit Augenmaß zu reduzieren“.
Politisch steht Hochs Idee jedoch auf dünnem Eis. Arbeitgeberverbände und Teile der Union lehnen den Plan als „falsches Signal“ ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund zeigt sich gespalten – Vertrauen ja, aber bitte mit Absicherung.
Eine Idee zwischen Pragmatismus und Provokation
Clemens Hochs Vorstoß zwingt Deutschland, über sein Verhältnis zu Arbeit und Vertrauen nachzudenken. Eine Gesellschaft, die bei jedem Husten einen Stempel verlangt, wird Bürokratie nie los. Doch eine, die Kontrolle völlig aufgibt, riskiert Missbrauch.
Zwischen diesen Polen liegt der Kern der Debatte: Wie viel Vertrauen verträgt der Sozialstaat – und wie viel Kontrolle braucht er noch?