Ein kleines Signal mit großer Tragweite
Peking hat geliefert. Zum ersten Mal seit Oktober greift die chinesische Zentralbank wieder aktiv in den Zinsmarkt ein – und sendet damit ein unmissverständliches Signal: Die wirtschaftliche Lage ist ernst, die politische noch ernster.
Mit der Senkung des einjährigen Leitzinses um zehn Basispunkte auf nun 3,0 % soll die Kreditvergabe angekurbelt werden. Parallel fiel auch der fünfjährige Leitzins – wichtig für Immobilienkredite – auf 3,5 %.
Auf dem Papier ein überschaubarer Eingriff. Doch zwischen den Zeilen steckt mehr: Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt versucht, den steigenden wirtschaftlichen Druck – nicht zuletzt durch neue US-Zölle – mit einer Mischung aus geldpolitischer Lockerung und strategischer Schadensbegrenzung zu beantworten.
Pekings Reaktion auf ein globales Dilemma
Die Zinssenkung ist Teil eines umfassenderen Konjunkturpakets, das zuletzt angekündigt wurde: Liquiditätsspritzen, gezielte Kreditprogramme, Entlastung der Provinzen.
Doch der Spielraum ist begrenzt. Chinas strukturelle Probleme – Überkapazitäten, Immobilienkrise, schwaches Vertrauen der Konsumenten – lassen sich nicht einfach wegspritzen.
Hinzu kommt: Die Volksrepublik agiert in einem immer raueren außenwirtschaftlichen Klima. US-Präsident Donald Trump – seit seiner Wiederwahl mit neuem Schwung – hat die Zölle auf chinesische Elektroautos, Halbleiter und Solarprodukte drastisch erhöht. Der protektionistische Kurs in Washington zwingt Peking zum Handeln.
Die Zinssenkung ist also nicht nur konjunkturpolitisch motiviert, sondern auch geopolitisch: Sie soll Zeit kaufen, Kapital mobilisieren und möglicherweise ein Abgleiten der Binnenwirtschaft in eine längerfristige Stagnation verhindern.
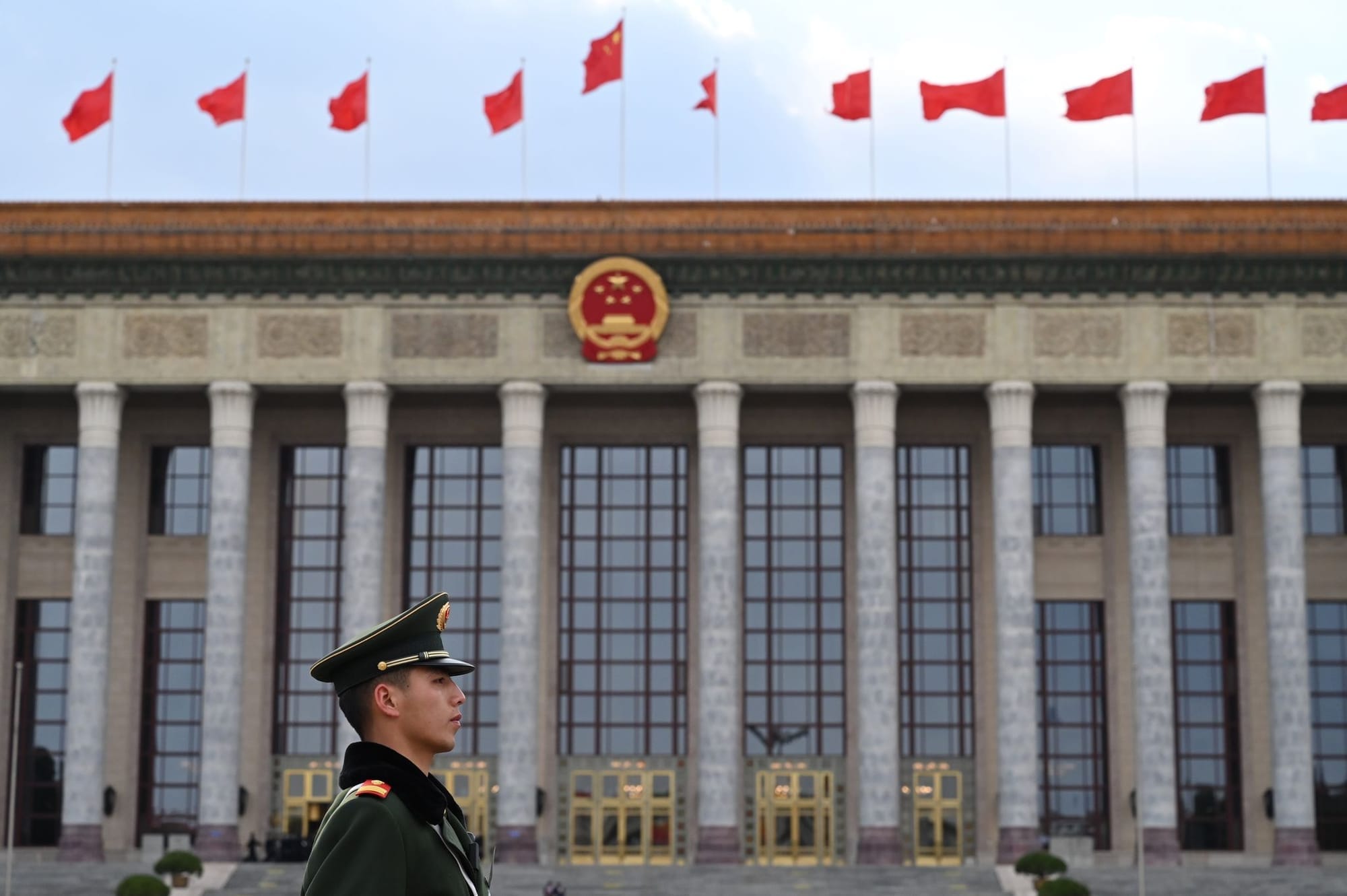
Ein Signal an die Immobilienbranche – und an die Mittelschicht
Die gleichzeitige Senkung des fünfjährigen LPR-Satzes ist mehr als eine technische Anpassung. Sie zielt direkt auf Chinas taumelnden Immobiliensektor. Die Regierung weiß: Ohne stabile Bauaktivität und halbwegs funktionierenden Hypothekenmarkt ist keine wirtschaftliche Erholung denkbar.
Doch der Vertrauensverlust sitzt tief. Millionen chinesischer Haushalte haben in den letzten Jahren durch platzende Bauträger, halbfertige Wohnprojekte und sinkende Immobilienpreise Kapital verloren – und Vertrauen gleich mit.
Die Zinssenkung ist daher auch psychologisch motiviert: Der Mittelklasse soll vermittelt werden, dass der Staat handlungsfähig bleibt. Es ist eine Einladung zum Schuldenmachen, unterlegt mit der Hoffnung, dass die Nachfrage zurückkehrt.
China lockert – während der Westen auf der Bremse steht
Das globale Timing könnte kaum unterschiedlicher sein: Während die Europäische Zentralbank und die US-Fed über vorsichtige Zinssenkungen diskutieren, aber bislang abwarten, drückt Peking aufs Gas. Die Notenbank geht damit bewusst ein Risiko ein – etwa in Form eines schwächeren Yuan, Kapitalabflüssen oder neuer Preisblasen.
Doch Alternativen fehlen. Die klassische chinesische Wachstumserzählung – Exporte, Infrastruktur, Immobilien – gerät zunehmend unter Druck. Das neue Narrativ heißt „qualitatives Wachstum“, doch noch fehlt ein belastbares Modell.
Für Anleger wird die Frage sein: Wie lange kann China die Erwartungen mit billigem Geld bedienen, ohne den langfristigen Reformpfad aus den Augen zu verlieren?
Zahlen, Daten, Druckpunkte
- Der einjährige Leitzins (LPR) liegt jetzt bei 3,0 % – das ist der Referenzwert für die meisten kurzfristigen Verbraucherkredite.
- Der fünfjährige LPR, entscheidend für Hypotheken, wurde auf 3,5 % gesenkt.
- Chinas Bruttoinlandsprodukt wuchs im ersten Quartal 2025 nur um 4,2 % – deutlich unter dem offiziellen Jahresziel von 5,0 %.
- Die US-Zölle auf chinesische Elektroautos und Technologieprodukte wurden Anfang Mai 2025 stark erhöht – mit direktem Effekt auf Exporte und Investitionsklima.
Wird das reichen?
Die entscheidende Frage bleibt offen. Die Zinssenkung ist ein taktischer Schritt – aber kein strategischer Befreiungsschlag. Das Vertrauen der Bürger, der Immobilienkäufer, der Investoren – es lässt sich nicht mit zehn Basispunkten zurückkaufen.
Chinas Notenbank hat das getan, was sie tun konnte. Jetzt liegt der Ball bei der Politik – und bei der globalen Konjunktur. Viel Zeit bleibt nicht.
Das könnte Sie auch interessieren:


