Hitze, die bleibt
Die Wochenmitte bringt den bislang heißesten Tag des Jahres. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Temperaturen bis zu 40 Grad – und spricht von „außergewöhnlicher Wärmebelastung“. Besonders betroffen sind der Westen und Südwesten, doch die Hitzewelle rollt bis in den Norden. Was früher Ausreißer war, ist heute Regel.
Seit den 1980er-Jahren nehmen Hitzewellen in Deutschland spürbar zu. Im Süden mehr als im Norden, am deutlichsten im Rhein-Main-Gebiet. Heiße Tage mit mehr als 30 Grad gibt es heute fünfmal so häufig wie noch vor 70 Jahren. Auch Tropennächte – Nächte, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt – sind längst keine Seltenheit mehr.
Das ist kein Zufall. Die globale Erwärmung ist da. Und sie zeigt sich besonders eindrucksvoll in solchen Sommern.
Wenn Städte nicht mehr schlafen
Dass es nicht mehr richtig abkühlt, ist kein Schönheitsfehler – sondern ein ernstes Problem. Tropennächte belasten den Körper, lassen ihn nicht mehr regenerieren. Schlafmangel, Kreislaufprobleme, mehr Notfälle in Krankenhäusern. Besonders gefährdet: ältere Menschen, Herzkranke, Kleinkinder.
Die Zahl der Hitzetoten steigt. 2003 starben laut Schätzungen rund 10.000 Menschen in Deutschland durch die Folgen einer Hitzeperiode. Auch 1994 war verheerend. Und seither? Verbesserte Vorsorge, ja – aber längst nicht flächendeckend.
In vielen Schulen, Pflegeheimen und Krankenhäusern sind die Räume unklimatisiert. Der aktuelle Hitzeschutzplan des Bundesgesundheitsministeriums wirkt seltsam weltfremd: Das Wort „Klimaanlage“ kommt darin kein einziges Mal vor.

Die große Dürre – oder doch nicht?
Was die Hitze begleitet, ist eine ungewöhnlich lange Trockenphase. Seit Februar hat es vielerorts kaum geregnet. Der Deutsche Wetterdienst spricht von der trockensten Phase seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Dennoch hat die Trockenheit bislang kaum ernste Folgen – weil die Jahre zuvor sehr feucht waren.
Heißt das: Der Klimawandel bringt mehr Dürre? Überraschende Antwort: nicht unbedingt. Langfristige Daten zeigen für Mitteleuropa keinen eindeutigen Trend. Rekonstruktionsstudien über die letzten 500 Jahre belegen: Frühere Dürren waren oft länger, intensiver – und teils katastrophaler.
Ein Beispiel: 1540 blieb es in Deutschland fast ein ganzes Jahr trocken. Die Ernten fielen aus, es kam zu Hunger, Bränden, Seuchen. Auch im 15. Jahrhundert waren Dürreperioden über Jahrzehnte hinweg keine Seltenheit. Der Unterschied: Damals sprach niemand von „Klimakatastrophe“.
Mehr Regen – aber zur falschen Zeit
Klimaforscher sind sich einig: Insgesamt fällt in Deutschland heute mehr Regen als früher. Der Unterschied liegt in der Verteilung. Frühling und Winter werden feuchter, der Sommer trockener. Was paradox klingt, hat ernste Folgen: Felder verdorren, Böden reißen, Bäume sterben.
Gleichzeitig steigen die Pegel vieler Flüsse im Winter – mit Überschwemmungen als Nebenwirkung. Die Folgen des Klimawandels sind also nicht nur heiß, sondern auch nass. Und beides kann gleichzeitig wahr sein.
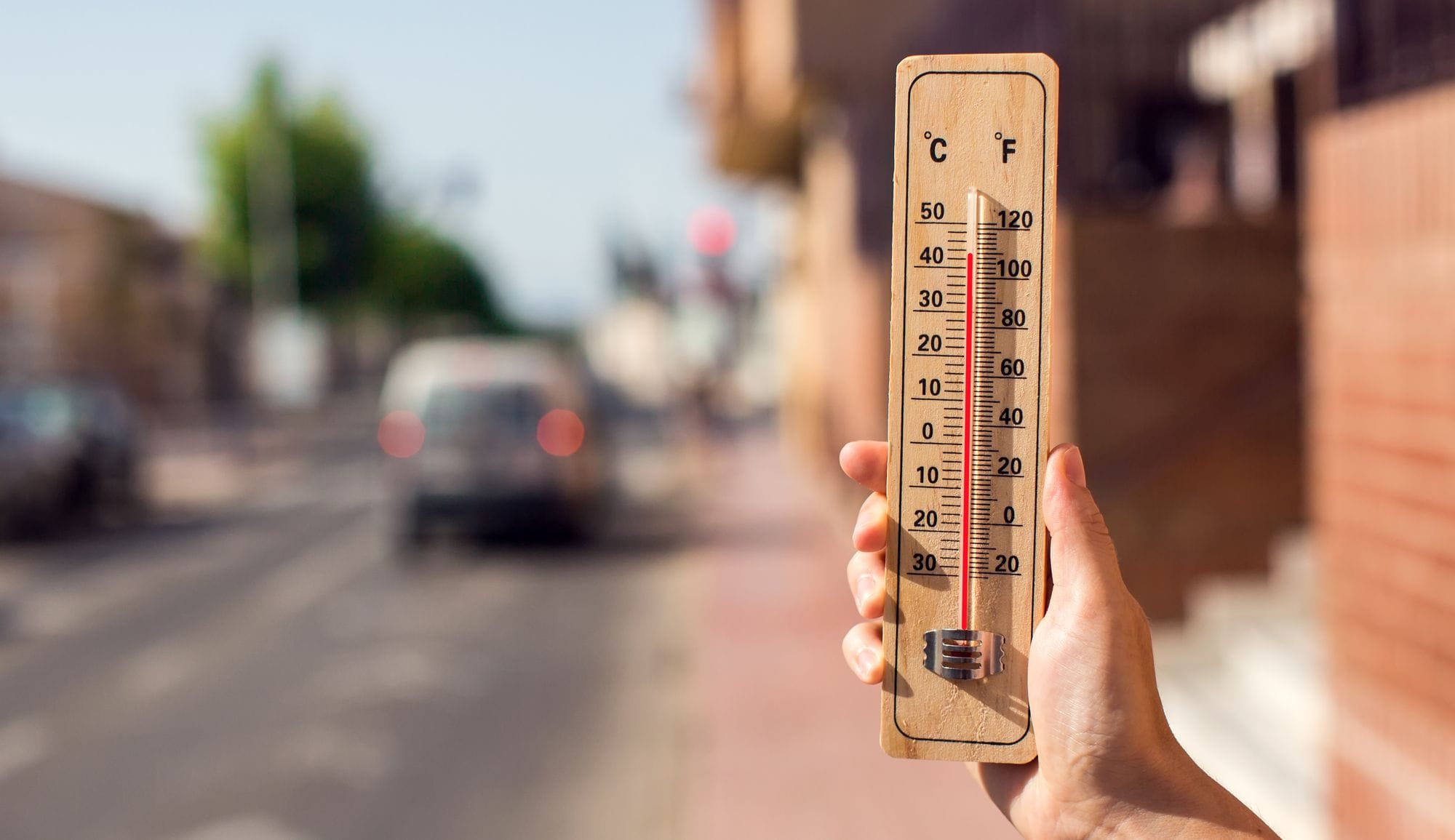
Politik im Schatten
Was auffällt: Während über die Ursachen des Klimawandels viel gestritten wird, passiert beim Schutz vor seinen Folgen erstaunlich wenig. Noch immer fehlt in vielen Städten ein funktionierender Hitzeschutz. Noch immer werden Neubauten ohne Verschattungs- oder Kühlkonzepte genehmigt.
Dabei sagen Experten ganz klar: Mit den richtigen Maßnahmen ließe sich die Sterblichkeit durch Hitze auf Null drücken. Begrünte Städte, klimatisierte öffentliche Gebäude, klare Informationspolitik – all das kostet Geld. Aber weniger, als nichts zu tun.
Komplexer als gedacht
Ja, die Hitzewelle hat mit dem Klimawandel zu tun. Und ja, sie wird häufiger. Die Dürre dagegen ist ein komplexeres Thema. Es gibt sie – aber nicht jede Trockenheit ist automatisch Klimafolge. Was fehlt, ist weniger Panikmache – und mehr konkrete Anpassung.
Denn fest steht: Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Die Frage ist nur, ob wir dann besser vorbereitet sind.
Das könnte Sie auch interessieren:


