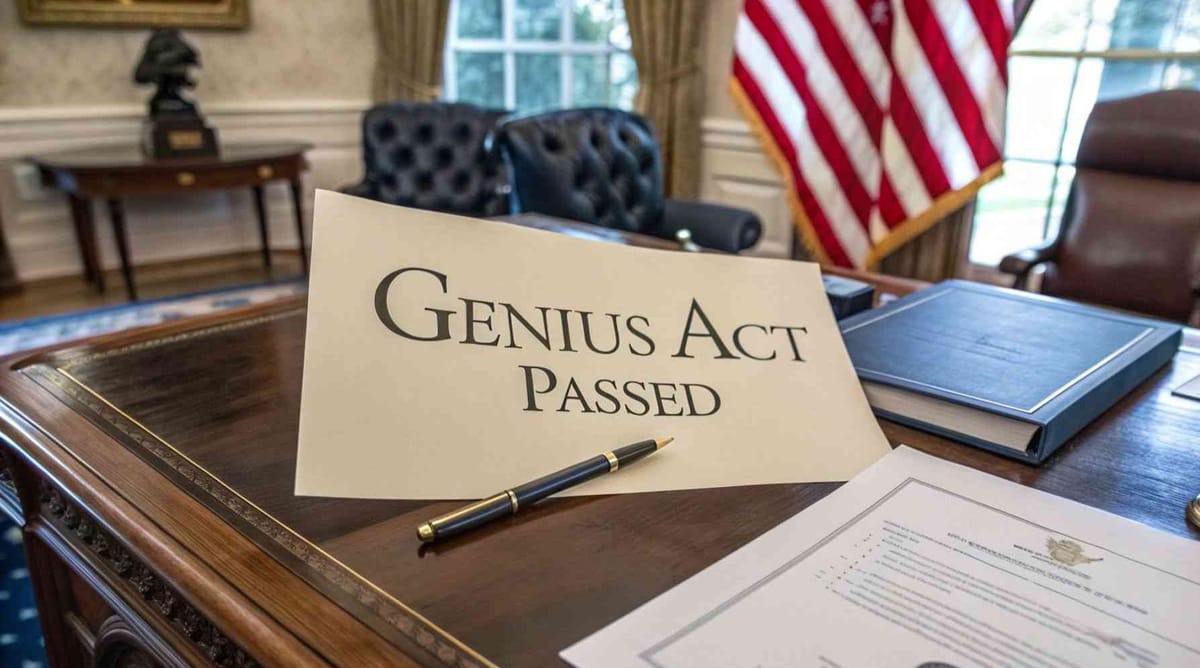Ein Paukenschlag im East Room
Donald Trump war sichtlich zufrieden. In einer gewohnt selbstreferenziellen Rede erklärte er, das neue Gesetz sei „ein verdammt gutes Gesetz – benannt nach mir“. Und tatsächlich: Der „Guarding and Enabling Nation’s Innovation in US-Stablecoins Act“, kurz GENIUS Act, dürfte als Meilenstein in die Geschichte der Finanzregulierung eingehen.
Zum ersten Mal erhalten Stablecoins wie Tether und USDC einen rechtlich definierten Rahmen – ein 250-Milliarden-Dollar-Markt bekommt Regeln. Doch was auf den ersten Blick wie ein Fortschritt wirkt, ist bei näherem Hinsehen ein gefährliches Spiel mit dem Machtgleichgewicht im globalen Finanzsystem.
Ein Deal, gemacht am Telefon – und über Bande
Der Weg zur Verabschiedung war alles andere als reibungslos. Noch am Vortag blockierten zwölf republikanische Hardliner das Gesetz. Erst persönliche Anrufe Trumps – „Sie wollen einfach ein bisschen Liebe“, wie er spöttisch sagte – brachten die nötige Mehrheit.
Mit 206 Republikanern und 102 Demokraten wurde der GENIUS Act schließlich durch das Repräsentantenhaus gewunken. Auch Vizepräsident J.D. Vance spielte eine Schlüsselrolle, indem er laut Trump „nächtelang durchtelefonierte“. Es war ein politischer Kraftakt – aber auch ein Beleg dafür, wie sehr Trumps Stil von Personalpolitik und Loyalität die US-Gesetzgebung prägt.
Stablecoins mit Gütesiegel – aber zu welchem Preis?
Kern des GENIUS Act ist die Einführung eines Lizenzsystems für Stablecoin-Emittenten. Nur Unternehmen mit Genehmigung der US-Bankenaufsicht dürfen künftig digitale Dollar-Token herausgeben. Damit wird der Markt nicht nur reguliert, sondern auch stark konsolidiert.
Branchenführer wie Circle, Paxos oder Tether profitieren – kleinere Start-ups könnten untergehen. Der Zugang zum Dollar wird zur geopolitischen Waffe: Wer künftig Dollar-Stablecoins nutzen will, muss sich dem amerikanischen Finanzrecht unterwerfen. Für US-Firmen ein Heimspiel – für internationale Wettbewerber eine neue Hürde.
Kampfansage an die Notenbanken
Noch brisanter als der GENIUS Act sind die beiden begleitenden Gesetze: Der „Clarity Act“ definiert erstmals, welche digitalen Vermögenswerte als Wertpapiere gelten – eine lange überfällige Reform nach jahrelangem Streit zwischen SEC und Kryptoindustrie.

Der „Anti-CBDC Surveillance State Act“ hingegen verbietet es der US-Zentralbank, eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) direkt an Verbraucher auszugeben. Trump nutzt die Kryptodebatte, um sich als Verteidiger der Privatsphäre zu inszenieren – und attackiert damit direkt die Federal Reserve. Es ist ein ideologischer Frontalangriff auf die Notenbankpolitik.
Bitcoin bleibt nervös – doch die Richtung ist klar
Trotz der Euphorie blieb die Reaktion am Markt verhalten. Der Bitcoin fiel am Tag der Unterzeichnung leicht auf 117.616 Dollar, notiert damit aber weiterhin rund zwölf Prozent höher als vor einem Monat. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 26 Prozent zu Buche.
Die neuen Regeln dürften langfristig als Legitimation wirken – und institutionellen Investoren Sicherheit geben. Doch kurzfristig bleibt die Unsicherheit groß: Was, wenn andere Länder den US-Ansatz nicht mittragen? Was, wenn der nächste Präsident die Gesetze wieder kippt?
Ein Machtinstrument mit offenem Ende
Der GENIUS Act bringt Ordnung in ein bislang unreguliertes Marktsegment – keine Frage. Aber er verlagert die Kontrolle über den digitalen Dollar vom Staat in die Hände privater Unternehmen, deren Interessen nicht zwangsläufig mit dem Gemeinwohl übereinstimmen.
Und er stellt das Fundament des traditionellen Zentralbankwesens in Frage. In Trumps Händen wird Regulierung zur Waffe – gegen politische Gegner, gegen China, gegen „Big Government“.
Das könnte Sie auch interessieren: