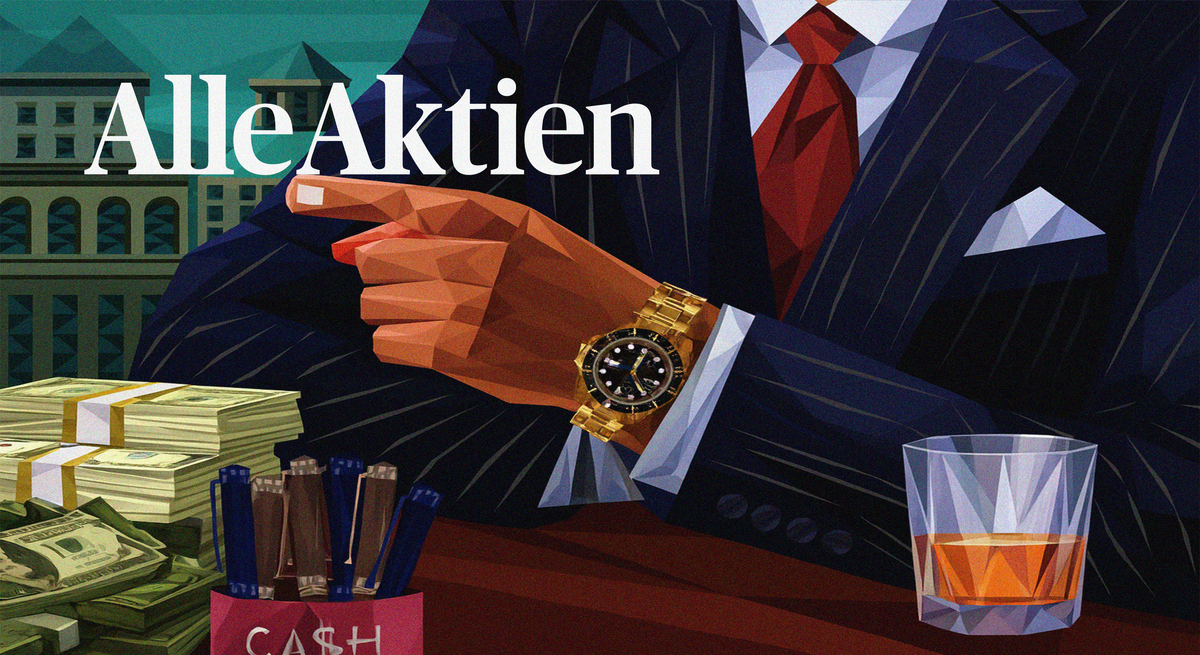Der Fall Taleb A. legt ein eklatantes Kommunikationsversagen der Behörden offen
Monate bevor Taleb A. am 20. Dezember 2024 mit einem Auto in die Besuchermenge des Magdeburger Weihnachtsmarkts raste und sechs Menschen tötete, lagen bei der Polizei Hinweise vor, die seine Tätigkeit im Maßregelvollzug infrage gestellt hätten. Dass diese Warnungen versandeten, zeichnet der Untersuchungsausschuss des Landtags nun klarer denn je nach – und stellt der Sicherheitsarchitektur des Landes ein bedrückendes Zeugnis aus.

Die Warnung blieb im Apparat stecken
Im September 2023 führten Staatsschützer im Salzlandkreis eine Gefährderansprache bei Taleb A. durch. A. hatte zuvor die Kölner Staatsanwaltschaft bedroht, ein Vorgang, der eigentlich jeden Alarmmechanismus hätte auslösen müssen.
Doch der Staatsschutz-Sachgebietsleiter berichtet im Ausschuss, die Polizisten hätten ihre Bedenken zwar beim Revierleiter hinterlegt – was danach geschah, wisse niemand. Eine Weiterleitung an das Innenministerium oder an den Maßregelvollzug blieb offenbar aus.
Die Parallelen zu bekannten Behördenversäumnissen liegen offen: Hinweise wurden dokumentiert, aber nicht verknüpft. Informationen existierten, aber sie fanden ihren Weg nicht dorthin, wo sie Konsequenzen hätten auslösen müssen.
Fehlende Kommunikation innerhalb der Polizei
Noch problematischer wird das Bild durch die Aussagen des Anzeigenbearbeiters. Er wusste nach eigenen Angaben weder von den Ergebnissen der Gefährderansprache noch davon, dass Taleb A. in weiteren Verfahren Beschuldigter war.
Ein Revier, das zentrale Informationen nicht teilt, schafft blinde Flecken – und genau in diesem Raum konnte A. weiterarbeiten, ausgerechnet als Psychiater im Maßregelvollzug.
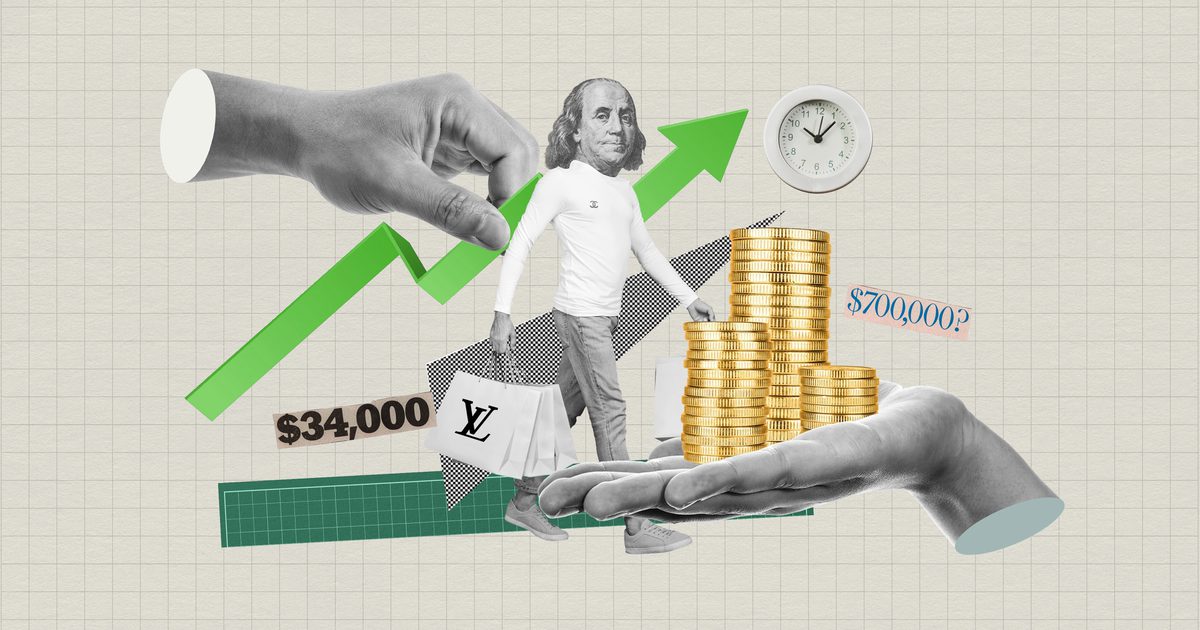
Für FDP-Obmann Guido Kosmehl ist das Versagen offensichtlich: Der Informationsaustausch müsse „dringend“ verbessert werden. Grünen-Obmann Sebastian Striegel stellt zudem die Frage, ob der Arbeitgeber von Taleb A. rechtzeitig gewarnt wurde – eine Frage, die inzwischen zur Systemprüfung wird.
Der Anschlag von Magdeburg bleibt ein Wendepunkt
Der Angriff vom 20. Dezember 2024 war einer der schwersten Terrorakte der vergangenen Jahre. Sechs Menschen starben, darunter ein neunjähriges Kind. 323 Menschen wurden verletzt. Die Wucht der Tat und die Zufälligkeit des Ortes – ein Weihnachtsmarkt im Abendbetrieb – machten das Ereignis zu einer kollektiven Zäsur.
Seit Mitte November läuft der Prozess gegen den Mann aus Saudi-Arabien. Parallel arbeitet der Untersuchungsausschuss an der politischen und verwaltungstechnischen Aufarbeitung. Bis Frühjahr 2026 soll ein Abschlussbericht vorliegen. Die Erwartungen sind hoch, denn der Fall berührt die Kernfrage jedes Sicherheitsapparats: Wie viele Warnsignale braucht ein System, um zu handeln?
Politiker fordern Aufklärung – und Verantwortung
Für den SPD-Obmann Rüdiger Erben ist der nächste Schritt klar: Der damalige Revierleiter soll als Zeuge geladen werden. Der Ausschuss will verstehen, warum Hinweise auf potenzielle Gefahr nicht eskalierten – und warum ein Mann mit mehreren laufenden Verfahren unbehelligt im sensibelsten medizinischen Bereich arbeiten konnte.
In den kommenden Monaten wird es nicht nur um Fehler gehen, sondern um strukturelle Bedingungen, die sie ermöglichten. Der Fall zeigt, wie schnell ein Versäumnis zur Katastrophe werden kann – und wie dünn die Grenze zwischen Warnsignal und Ignoranz manchmal ist.